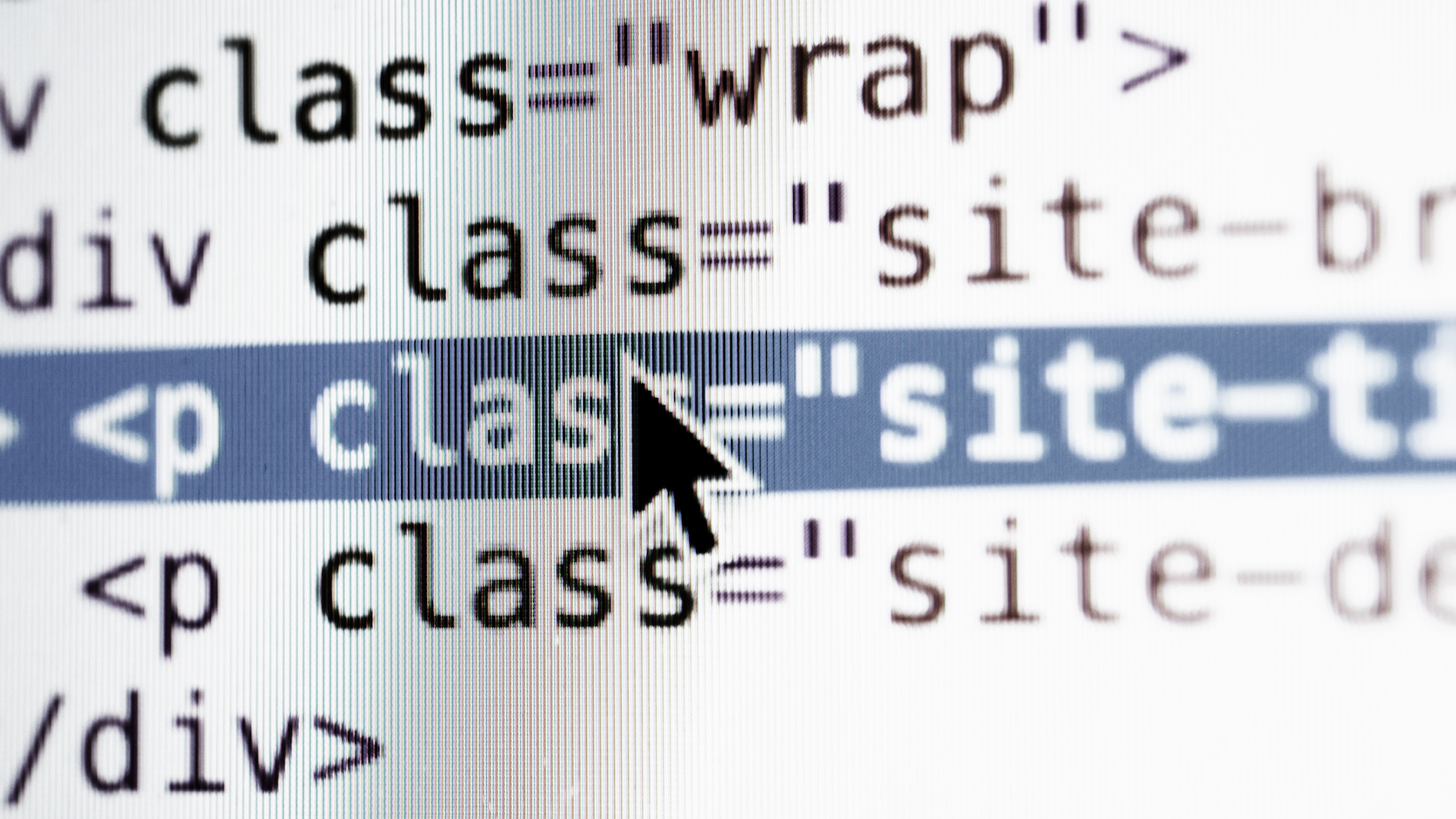BPatG München 6. Senat, Urteil vom 13.12.2024, AZ 6 Ni 42/22 (EP), ECLI:DE:BPatG:2024:240924U3Ni29.21EP.0
Tenor
In der Patentnichtigkeitssache
…
betreffend das europäische Patent EP 2 620 119
(DE 60 2009 033 451)
hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17. September 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richterin Dipl.-Phys. Univ. Dr. Schenkl und die Richter Dipl.-Ing. Veit, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dr. Söchtig
für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent 2 620 119 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass seine Ansprüche die nachfolgende Fassung erhalten:
1. A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device comprising: a flexible waveguide (200, 500, 600, 900) defining an elongated axis, a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and a rounded distal end receivable within the blood vessel and including a first radiation emitting surface (210, 510, 610) that emits radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (200, 500, 600, 900) and annularly from the waveguide (200, 500, 600, 900) onto an angularly extending portion of the surrounding vessel wall, wherein the emitting surface (210, 510, 610) is oriented at an acute angle with respect to the elongated axis of the waveguide (200, 500, 600, 900) and wherein the emitting surface (210, 510, 610) is substantially conical shaped, the device further comprising
– a lateral radiation emitting distal region (204, 504, 604) defined by the first radiation emitting surface (210, 510, 610) and a plurality of second radiation emitting surfaces (208, 508, 608) axially spaced relative to each other along a distal region of the waveguide (200, 500, 600, 900), wherein the plurality of second radiation emitting surfaces (208, 508, 608) are located proximally with respect to the first radiation emitting surface (210, 510, 610) and axially spaced relative to each other,
– a cover (206, 506, 606, 906) that is fixedly secured to the waveguide (200, 500, 600, 900) and sealed with respect thereto, substantially transparent with respect to the emitted radiation, that encloses the emitting surface (210, 510, 610) therein, and that defines a gas-waveguide interface that refracts emitted radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (200, 500, 600, 900) onto the surrounding vessel wall, wherein the axially-extending cover (206, 506, 606, 906) encloses the lateral radiation emitting distal region (204, 504, 604), forms a gas interface at each of the plurality of second radiation emitting surfaces (208, 508, 608) that is sealed with respect to the exterior of the waveguide (200, 500, 600, 900), and cooperates with the angled arcuate surface contour of at least a plurality of the radiation emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610) to deflect radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (200, 500, 600, 900), and
– at least one laser source (424) that provides laser radiation of 1470 nm +/- 30 nm or 1950 nm +/- 30 nm, wherein the proximal end of the waveguide (200, 500, 600, 900) is optically coupled to the at least one laser source (424).
2. The device according to claim 1,
further comprising a reflecting surface (212, 512, 612) distally spaced relative to and facing the emitting surface (210, 510, 610) for reflecting forwardly directed radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (200, 500, 600, 900).
3. The device according to claim 2,
wherein the reflecting surface (212, 512, 612) defines an arcuate surface contour oriented at an acute angle with respect to the elongated axis of the waveguide (200, 500, 600, 900).
4. The device according to claim 3,
wherein the reflecting surface (212, 512, 612) is substantially conical shaped.
5. The device according to any one of claims 1 to 4,
wherein the spread of the annular beam is defined by an angle within the range of about 30° to about 40° and/or wherein the approximate center of the beam is preferably oriented at an angle within the range of about 70° to about 90° relative to the elongated axis of the waveguide (200, 500, 600, 800, 900).
6. The device according to any one of claims 1 to 5,
further comprising a sleeve (946) slidably mounted over the waveguide (900) and defining an internal radiation reflective surface for reflecting laterally emitted radiation inwardly and controlling the axial length of the lateral radiation emitting distal region, and/or
further comprising a radiation source (424), a temperature sensor (426) thermally coupled to a distal region of the waveguide (420) for monitoring a temperature within the blood vessel and transmitting signals indicative thereof, and a control module (428) electrically coupled to the temperature sensor (426) for regulating the power output of the radiation source (424) based thereon, and/or
further comprising a pullback actuator (430) drivingly coupled to the waveguide (420) for controlling the pullback speed of the waveguide (420), and wherein the control module (428) is electrically coupled to the pullback actuator (430) for regulating the pullback speed of the waveguide (420) based on the temperature at the distal region of the waveguide (420).
7. The device according to any one of claims 1 to 6,
further comprising a guide wire (534, 634) detachably coupled to the waveguide (500, 600) and including a distal portion extending distally beyond the distal tip of the waveguide (500, 600) for guiding the waveguide (500, 600) through the blood vessel.
8. The device according to any one of claims 1 to 7,
wherein the waveguide is an optical fiber (200, 500, 600, 900) and wherein the cover is a cap (206, 506, 606, 906) that is fused to the fiber core.
9. The device according to any one of claims 1 to 8,
wherein the at least one laser source (424) provides laser radiation at a power of less than or equal to about 10 W and wherein the emitting surface (210, 510, 610) of the waveguide (200, 500, 600, 900) emits radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (200, 500, 600, 900) in an axially-extending, annular pattern onto the surrounding vessel wall.
10. The device according to claim 9,
wherein the laser source (424) provides power at less than 5 W.
11. The device according to any one of claims 1 to 10,
further comprising an electric pullback device (430) drivingly coupled to the wave-guide (200, 500, 600, 900) and configured to pullback the waveguide (200, 500, 600, 900) through the blood vessel while delivering laser radiation at an energy delivery rate of less than about 50 J/cm, 40 J/cm, 30 J/cm, 20 J/cm or 10 J/cm on average to the blood vessel wall.
II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
III. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ein Drittel und die Beklagte zwei Drittel.
IV. Das Urteil ist im Kostenausspruch jeweils gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand
1
Die Beklagte ist Inhaberin des am 2. März 2009 in englischer Sprachfassung angemeldeten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 620 119 mit der Bezeichnung „Endoluminal laser ablation device for treating veins (Endoluminale Laserablationsvorrichtung zur Behandlung von Venen)“. Das Streitpatent nimmt die Prioritäten von vier US-amerikanischen Anmeldungen, US 67537 vom 28. Februar 2008, US 79024 vom 8. Juli 2008, US 104956 vom 13. Oktober 2008 und US 395455 vom 27. Februar 2009, in Anspruch und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2009 033 451.4 geführt.
2
Seine geltende, durch die Klägerin insgesamt angegriffene Fassung hat das Streitpatent durch Urteil des Bundesgerichtshofs vom 7. September 2021 – X ZR 77/19 erhalten. In dieser Fassung umfasst das Streitpatent dreizehn Patentansprüche mit einem unabhängigen, auf eine Vorrichtung zur endoluminalen Laserablation gerichteten Patentanspruch 1 und den jeweils auf diesen Anspruch unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüchen 2 bis 13.
3
Die jetzige Klägerin benennt im Vergleich zum ersten Patentnichtigkeitsverfahren zusätzliche Dokumente als Stand der Technik und stützt sich auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit in Form fehlender erfinderischer Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 56 EPÜ).
4
Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der geltenden Fassung sowie mit insgesamt zwölf Hilfsanträgen vom 10. November 2023.
5
Der unabhängige Patentanspruch 1 hat in seiner geltenden Fassung folgenden Wortlaut:
6
1. A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device comprising: a flexible waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) defining an elongated axis, a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and a rounded distal end receivable within the blood vessel and including a radiation emitting surface (110, 210, 510, 610) that emits radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and annularly from the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) onto an angularly extending portion of the surrounding vessel wall, wherein the emitting surface (110, 210, 510, 610) is oriented at an acute angle with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and wherein the emitting surface (110, 210, 510, 610) is substantially conical shaped, the device further comprising
7
– a cover (106, 206, 506, 606, 906) that is fixedly secured to the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and sealed with respect thereto, substantially transparent with respect to the emitted radiation, that encloses the emitting surface (110, 210, 510, 610) therein, and that defines a gas-waveguide interface that refracts emitted radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) onto the surrounding vessel wall,
8
– at least one laser source (424) that provides laser radiation of 1470 nm +/- 30 nm or 1950 nm +/- 30 nm, wherein the proximal end of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) is optically coupled to the at least one laser source (424).
9
Zum Wortlaut der Unteransprüche wird auf die geänderte Patentschrift DE 60 2009 033 451 C5 Bezug genommen.
10
Ihren Vortrag zur fehlenden Patentfähigkeit stützt die Klägerin auf folgende Dokumente:
11
N1 EP 0 292 695 A2
12
N2 DE 31 19 322 A1
13
N3 US 4,842,390
14
N4 Lexikon der Optik, Erster Band A bis L, Hrsg.: Harry Paul, Spektrum Akademischer Verlag Berlin, 1999, S. 403-404
15
N5 DE 197 03 208 A1
16
N6 DE 39 41 705 A1
17
N7 US 5,303,324
18
N8 DE 101 02 477 A1
19
N9 US 5,242,438
20
N10 DE 44 03 134 A1
21
N11 DE 196 30 255 A1
22
N12 EP 0 152 766 A1
23
N13 EP 0 232 511 A1
24
N14 US 6,143,018
25
N15 US 2004/0092913 A1
26
N16 US 5,196,005
27
N17 DE 39 01 931 A1
28
N18 US 4,850,351
29
N19 Burgmeier: Endoluminale Behandlung der Varikosis: Analyse der Rolle kollagener Fasern und experimentelle Evaluation der thermischen Gewebeveränderungen durch Laser- und Radiofrequenzenergie, Dissertation, LMU München: Medizinische Fakultät, URL: https://e-docundub.uni-muenchen.de/8914/, eingestellt am 22. August 2008
30
N20 Puls et al.: Laserinduzierte interstitielle Thermotherapie (LITT) – Anwendung runder und spitzer Laserapplikatorsysteme – erste Ergebnisse, Fortschr. Röntgenstr., Vol. 173, No. 3, 2001, S. 263-265, Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York, ISSN 1438-9029
31
N21 US 5,537,499
32
N23 Sottini et al.: Probe for laser angioplasty radiating a corolla shaped beam, Applied Optics, Vol. 28, No. 5, 1, März 1989, S. 995-999
33
N24 US 9 693 826 B2
34
N26 Auszug zum Begriff „Lichtstreuung“ aus dem Lexikon der Optik, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg-Berlin, Bd.1, 1999
35
N27 Auszug aus dem Online-Lexikon Wikipedia zum Begriff Angioplastie, URL: https://de.wikipedia,org/wiki/ Angioplastie, abgerufen am 5. Februar 2018
36
N28 Reuther et al.: Durchmesser der Vena saphena magna in der Krossenregion bei gesunden Venen und primärer Stammvarikosis, Phlebologie, Vol. 28, 1999, S. 48 – 52
37
N31/
38
N31A Heinze et al.: Modified fiber tips for light application in hollow organs, in: Proc. SPIE 1201, optical fibers in medicine V, 1. Juli 1990, S. 304-312
39
N32 Stellenbeschreibung eines R&D Managers
40
N33 Forschungsbericht 2005-2006 LIFE, Klinikum der Universität München, S. 1 – 9
41
N34 EP 2 620 119 A2 (urspr. Anmeldungsunterlagen des Streitpatents)
42
N35 Waidelich et al.: Laser in der Medizin/in Medicine – Vorträge des 10. Internationalen Kongresses/Proceedings of the 10th International Con-gress, Springer Verlag
43
N36 Oesophageal atresia/Orphanat Journal of Rare Diseases (Full text), URL: https://ojrd.biomedcentral.eom/articles/10.1186/1750-1172-2-24
44
N37 Yang Ni et al.: Case Report – Simple strategy of anesthesia for the neonate with tracheoesophageal fistula: a case report, eingereicht am 23. Oktober 2013; akzeptiert am 19. November 2013; Epub 15. Januar 2014; Publiziert 30. Januar 2014, Int J Clin Exp Med, Vol. 7, No. 1, S. 327-328, URL: www.ijcem.eom/ISSN:1940-5901/lJCEM1310033
45
N38 Knottenbelt et al.: Tracheo-oesophageal fistula (TOF) and oesophageal atresia (OA), BestPractice & Research Clinical Anaesthesiology, Vol. 24, No. 3, 2010 S. 387-401
46
N39 Roche Lexikon Medizin, Hrsg.: Hoffmann-La Roche AG und Urban & Fischer, Fünfte Auflage 2003, S. 241
47
N40 Der Große Brockhaus, Zwölfter Band VEK-ZZ, 18. Auflage, Hrsg. F. A. Brockhaus, Wiesbaden, Vene, S. 12; Der Große Brockhaus, Zweiter Band BEG-DAM, 18. Auflage, Hrsg. F. A. Brockhaus, Wiesbaden, Blut
48
N41 Organe.de – Die Blutgefäße, URL: https://organe.de/blutgefaesse/, abgerufen am 11.02.2020
49
N42 Blutgefäß – DocCheck Flexikon Blutgefäß, URL: https://flexikon.doccheck.com, abgerufen am 03.03.2020
50
N43 WO 01/03596 A1
51
N44 US 2007/0100329 A1
52
N45 EP 0 311 295 A2
53
N50 US 2005/0131400 A1
54
N51 Kalra et al.: Fifteen Years Ago Laser was Supposed to Open Arteries, Now it is Supposed to Close Veins: What is the Reality Behind the Tool?, Perspectives in Vascular Surgery and Endovascular Therapy; Vol. 18, No. 1, 2006, S. 3 – 8.
55
N59 US 61/067,537 P
56
N60 US 61/079,024 P
57
N61 US 61/104,956 P
58
N62 US 12/395,455
59
N63 Russo et al.: Axially and side – radiating optical fibres for medical applications, SPIE, Vol. 492 ECOOSA ’84 (Amsterdam), 1984, S. 466-473
60
N64 Russo et al.: Optical fibres for medical applications output beam shaping, SPIE Vol. 522 Fibre Optics ’85 (Sire), 1985, S. 166-173
61
N65 US 2007/0049911 A1
62
N66 Auszug aus dem Online-Lexikon Wikipedia zum Begriff Nd:YAG-Laser, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/ Nd:YAG-Laser, abgerufen am 04.02.2022
63
N67 Kouba et al.: Nevus of Ota Successfully Treated by Fractional Photothermolysis Using a Fractinated 1440-nm Nd:YAG-Laser, Archives of dermatology, Vol. 144, No. 2, 1. Februar 2008, S. 156-158 URL:https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/ fullarticle/419317, abgerufen am 04.02.2022
64
N68 EP 0 367 516 A1
65
N69 WO 2007/058891 A2
66
N70 WO 2008/033367 A2
67
N71 US 2005/0015123 A1
68
N72 US 4,625,724
69
N73 US 5,292,320
70
N74 US 5,807,389
71
N75 Lahl et al.: 1.470 nm-Laser zur endovenösen Varizenablation – erste Erfahrungen, 13. Bonner Venentage, Vasomed, Vol. 19, No. 1, 2007, S. 30
72
N76 Dreiländertagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie, 5. bis 8. September 2007 in Basel, Gefäßchirurgie, Vol. 12, 2007, S. 269-309, insbesondere C. Burgmeier et al., Die endoluminale Laserbehandlung der Varikosis: Einfluss des verwendeten Lichtwellenleiters, der Laserwellenlänge und der Energiedichte, Zusammenfassung 100, S. 307.
73
N77 FDA (Food and Drug Administration) Anmeldung von Biolitec
74
N78 Phlebologische Leistungen am Herz-Zentrum – Die endovenöse Lasertherapie von Varizen (EVLT), Krankenhauszeitschrift Herz-Zentrum Bad Krozingen, S. 23, Bereiche und Abteilungen 4/2007
75
N79 Russo et al.: Side Radiation optical fibers for medical applications, Porphyrins in Tumor Phototherapy, 1984, S. 309-319
76
N80 Russo: Optical Fibre Delivery Systems for Laser Angioplasty and Laser Treatment of Tumours, Lasers in Medical Science Vol. 3, 1988, S. 207-211
77
N81 Seitz et al.: The Diode Laser: A Novel Side-Firing Approach for Laser Vaporisation of the Human Prostate-Immediate Efficacy and 1-Year Follow-Up, European Urology, Vol. 52, No. 6, S. 1717-1722, URL: www.sciencedirect.com, journal homepage: www.europeanurology.com
78
N82 Spaniol et al.: Diffusing Fiber Tips for High-Power Laser Application, Laser in der Medizin/Laser in Medicine: Vorträge der 10. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Lasermedizin und des 12. Internationalen Kongresses Proceedings of the 12th International Congress Laser 95, 1996, S. 526-529.
79
N83A Verdaasdonk: Fiber delivery Systemen voor medische laser toepassingen, Nederlands Tijdschrift voor Fotonica, November 1992, S. 4-13
80
N83B Maschinenübersetzung zu
N83A in deutscher Sprache
81
N84 EP 0 214 712 A1
82
N85 DE 101 02 477 A1 (s. N8)
83
N86 WO 01/08576 A2
84
N87 EP 1 574 176 A1
85
N88 WO 2005/004737 A1
86
N89 US 2006/0235373 A1
87
N90 EP 1 933 894 A0
88
N91 FR 2 875 122 A1
89
N92 US 2002/0052621 A1
90
N93 Anlagenkonvolut (N93-1 bis N93-9)
91
N93-1 Paithankar et al.: Acne Treatment with a 1,450 nm Wavelength Laser and Cryogen Spray Cooling, Lasers in Surgery and Medicine, Vol. 31, 2002, S. 106-114
92
N93-2 Gayen et al.: Aorta and Skin Tissues Welded by Near-Infrared Cr4+:YAG Laser, Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery Vol. 21, No. 5, 2003, S. 259-269,
93
N93-3 Phlebologische Leistungen am Herz-Zentrum – Die endovenöse Lasertherapie von Varizen (EVLT), Krankenhauszeitschrift Herz-Zentrum Bad Krozingen, S. 23, Bereiche und Abteilungen 4/2007 (s. N78)
94
N93-4 Havel et al.: Gewebekoagulation und -ablation mittels eines 1470 nm-Diodenlasersystems – In vitro Versuche und klinische Anwendung bei der Nasenmuschelhyperplasie, Meeting, Abstract, 79. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 30.04.2008-04.05.2008, veröffentlicht am 22. April 2008
95
N93-5 Lahl et al.: 1.470 nm-Laser zur endovenösen Varizenablation – erste Erfahrungen, 13. Bonner Venentage, Vasomed, Vol. 19, No. 1, 2007, S. 30 (s. N 75)
96
N93-6 Zeyen et al.: Miscalibration and Severe Complications after Diode Laser Cyclophotocoagulation: Two Case Reports, Bull. Soc. Belge Ophtalmol., Vol. 292, 2004, S. 27-30
97
N93-7 Seitz et al.: The Diode Laser: A Novel Side-Firing Approach for Laser Vaporisation of the Human Prostate-Immediate Efficacy and 1-Year Follow-Up, European Urology, Vol. 52, No. 6, S. 1717-1722, URL: www.sciencedirect.com, journal homepage: www.europeanurology.com (s. N81)
98
N93-8 Paithankar et al.: Subsurface skin renewal by treatment with a 1450-nm laser in combination with dynamic cooling. Journal of Biomedical Optics, Vol. 8, No. 3, Juli 2003, S. 545-551
99
N93-9 WO 2008/033367 A2 (s. N70)
100
N94 Anlagenkonvolut;(N94-1 bis N94-2)
101
N94-1 Goldman et al.: Intravascular 1320 nm Laser Closure of the Great Saphenous Vein: A 6- to 12-Month follow-up Study, Dermatol Surg, Vol. 30, 2004, S. 1380-1385,
102
N94-2 Apfelberg et al.: Use of the Argon and Carbon Dioxide Lasers for Treatment of Superficial Venous Varicosities of the Lower Extremity, Lasers in Surgery and Medicine Vol. 4, 1984, S. 221-231
103
N95 C. Steele, C. Waine: Management of diabetic retinopathy and diabetic maculopathy – laser, surgical and medical approaches. Argon-Laser, Link abgerufen am 2. Mai 2022
104
N96 DE 20 2009 018 508 U1
105
N97 Haupt- und Hilfsanträge zu DE 20 2009 018 508 U1 (
N96) vom 27. Mai 2022
106
N98 Aktenzeichen: 20 …, Niederschrift über die nicht öffentliche mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts
107
N99 Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA zu DE 20 …
108
N100 DocCheck Flexikon: zirkulär, abgerufen am 18.10.2023
109
N101 Google: radial definition
110
N102 EP 2 254 495 A0 (WO 2009 /108956)
111
N103 US 2007/0106286 A1
112
N104 WO 2008/073264 A2
113
N105 EP 0 689 797 A1
114
N106 EP 0 514 258 A1
115
N107 US 2006/0078265 A1
116
N108 EP 1 862 141 A1
117
N109 US 2007/0179488 A1
118
N110 EP 1 098 599 B1
119
N111 DE 195 46 447 A1
120
N112 US 6,398,777 B1
121
N113 erläuternde Zeichnung zur
N31/N31A
122
Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ausgehend von der Entgegenhaltung N50 in Kombination mit dem Offenbarungsgehalt einer der Entgegenhaltungen N63, N64 oder N65 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Gleiches gelte ausgehend vom Offenbarungsgehalt der N2 oder der N68 jeweils in Kombination mit N63, N64 oder N65 sowie ausgehend von der N31 in Kombination mit den in den Entgegenhaltungen des Anlagenkonvoluts N93 (N93-1 bis N93-9) genannten Wellenlängen. An erfinderischer Tätigkeit fehle es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 der geltenden Fassung auch ausgehend von einer der Entgegenhaltungen N69 bis N92 sowie ausgehend von der in der N31 beschriebenen Lasersonde in Kombination mit der N76. Ausgehend von der N76 werde sich der Fachmann die Frage stellen, wie eine Sonde aussehen solle, mit der eine Radialabstrahlung möglich ist, und so zu der in der N31 gezeigten Lasersonde gelangen. Das Streitpatent nehme im Übrigen die älteste beanspruchte Priorität vom 28. Februar 2008 nicht wirksam in Anspruch. Auch die Unteransprüche enthielten nichts Patentfähiges.
123
Die Klägerin beantragt,
124
das europäische Patent 2 620 119 in der geltenden Fassung mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.
125
Die Beklagte beantragt,
126
die Klage abzuweisen, sowie
127
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in den Fassungen der Hilfsanträge I bis XII vom 10. November 2023 – in dieser Reihenfolge – richtet.
128
Der Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fassung des
Hilfsantrags I unterscheidet sich von der geltenden Fassung dadurch, dass nunmehr eine Abdeckung beansprucht wird, die fest mit dem Wellenleiter verbunden und gegenüber diesem hermetisch abgedichtet ist:
129
“is fixedly secured to the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and
hermetically sealed with respect thereto,”.
130
Der Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Fassung des
Hilfsantrags II unterscheidet sich von der geltenden Fassung dadurch, dass die Aufweitung des ringförmigen Strahls durch einen Winkel im Bereich von etwa 30° bis etwa 40° definiert ist:
131
“
wherein the spread of the annular beam is defined by an angle within the range of about 30° to about 40°, and”.
132
In der Fassung des
Hilfsantrags III ist die Abdeckung der beanspruchten Vorrichtung im Vergleich zur geltenden Fassung des Patentanspruchs 1 fest mit dem Lichtleiter verbunden und gegenüber diesem durch Schmelzen abgedichtet:
133
„the device further comprising – a cover (106, 206, 506, 606, 906) that
134
is fixedly secured to the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and sealed with respect thereto
by fusion,”.
135
Die Fassung des
Hilfsantrags IV kombiniert die Änderungen der Hilfsanträge I und III gegenüber der geltenden Fassung des Patentanspruchs 1.
136
Die Fassung des
Hilfsantrags V kombiniert die Änderungen der Hilfsanträge I bis III gegenüber der geltenden Fassung des Patentanspruchs 1.
137
In der Fassung des
Hilfsantrags VI betrifft der Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Vergleich zur geltenden Fassung eine Vorrichtung zur endoluminalen Behandlung von Veneninsuffizienzen der Vena saphena magna:
138
“A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies
of the greater saphenous vein …”.
139
Die Fassung des
Hilfsantrags VII kombiniert die Änderungen der Hilfsanträge I bis III und VI der geltenden Fassung des Patentanspruchs 1.
140
Die Fassung des
Hilfsantrags VIII ist auf die Verwendung einer Vorrichtung zur endoluminalen Behandlung von Veneninsuffizienzen nach Maßgabe der geltenden Fassung des Patentanspruchs 1 gerichtet.
141
“
Use of a device for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device,
the device comprising:”.
142
Die Fassung des
Hilfsantrags IX betrifft demgegenüber die Verwendung einer Vorrichtung zur Bereitstellung eines Systems zur endoluminalen Behandlung von Veneninsuffizienzen nach Maßgabe der geltenden Fassung des Patentanspruchs 1:
143
“
Use of a device for
providing a system for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull- back-motion of the device,
the device comprising:”.
144
Durch die Fassung des
Hilfsantrags X wird – wiederum nach Maßgabe der in der geltenden Fassung des Patentanspruchs 1 beanspruchten Vorrichtung – ein Verfahren zur Bereitstellung eines Systems zur endoluminalen Behandlung von Veneninsuffizienzen unter Verwendung einer Vorrichtung beansprucht:
145
“
Method for
providing a system for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device,
using a device comprising:”.
146
Die Fassung des
Hilfsantrags XI entspricht der tenorierten Fassung.
147
Zur Fassung des
Hilfsantrags XII und zu den Fassungen der weiteren Ansprüche, welche die – jeweils als geschlossene Anspruchssätze beanspruchten – Fassungen der Hilfsanträge I bis X über den jeweiligen Patentanspruch 1 hinaus zusätzlich enthalten, wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 10. Januar 2023 Bezug genommen.
148
Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen wesentlichen Punkten entgegen. Sie erachtet die Gegenstände des Streitpatents in seiner geltenden Fassung, zumindest aber in den Fassungen der Hilfsanträge für patentfähig und stützt ihre Argumentation u. a. auf folgende Dokumente:
149
W01 Auszug aus dem Online-Lexikon Wikipedia zum Begriff „Reflexion (Physik)“; URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(Physik), Datum der letzten Bearbeitung 28. Oktober 2018
150
W02 Auszug aus dem Online-Lexikon Wikipedia zum Begriff „Lambertsches Gesetz“; URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Lambertsches_Gesetz, Datum der letzten Bearbeitung 24. April 2018
151
W03 Bennett: Characterization of Surface Roughness. In: Light Scattering and Nanoscale Surface Roughness; Maradudin A.A. (Editor), 2007 Springer Science+Business Media LLC, S. 1-33
152
W04 Voronovich: Wave Scattering from Rough Surfaces; Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1994, 1999, S. 1 bis 9
153
W05 Sekar et al.: Diffuse optical characterization of collagen absorption from 500 to 1700 nm, Journal of Biomedical Optics, Vol. 22 (1), Januar 2017
154
W06 Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine,“, URL http://web.archive.org/web/20071127233659/http://en.wikipedia.org:80/vviki/Nd:YAG_laser, Datum der letzten Bearbeitung 27. November 2007
155
W07 Auszug aus dem Internet-Archiv „Wayback-Machine,“, URL http://web.archive.org/web/20080914155714/http://de.wikipedia.org;80/wiki/Nd:YAG-Laser, Datum der letzten Bearbeitung 24. August 2008
156
W08 Auszug aus Kneubühl et al.: Laser, Teubner Studienbücher Physik, 2. Auflage, 1988, Vorwort, Inhaltsverzeichnis und S. 340 bis 351
157
W09 Auszug aus Kneubühl et al.: Laser, Teubner Studienbücher Physik Laserphysik, 6. Auflage, 2005, Vorwort, Inhaltsverzeichnis und S. 342 bis 357
158
W11 Auszug aus: Meyers Lexikon der Technik und der exakten Naturwissenschaften, Herausgegeben von den Fachredaktionen des Bibliographischen Instituts, Erster Band A – E, S. 781,1969
159
W12 Auszug aus dem Online-Lexikon Wikipedia zum Begriff „Numerical aperture“, undatiert
160
W13 Lebenslauf Prof. Dr. X …
161
W14 US 2007/0106286 A1.
162
Mit Schriftsatz vom 2. Juni 2022 hat die frühere Klägerin in diesem Verfahren, die Y … GmbH, einen Klägerwechsel auf die jetzige Klägerin mit deren Zustimmung erklärt.
163
Die Beklagte hat die jetzige ebenso wie die frühere Klägerin aus dem Streitpatent wegen Patentverletzung vor dem Landgericht in Anspruch genommen.
164
Der Senat hat den Parteien am 13. September 2022 einen Hinweis zur Frage der Zulässigkeit des Klägerwechsels und der Klage, am 25. Mai 2023 einen
165
qualifizierten Hinweis und im Termin vom 17. September 2024 einen weiteren rechtlichen Hinweis erteilt.
166
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung und den Akteneinhalt Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
167
Die nach wirksamem Klägerwechsel zulässige Klage hat nur hinsichtlich des elften Hilfsantrags Erfolg. Im Übrigen war sie abzuweisen.
I.
168
1. Durch den mit Schriftsatz vom 2. Juni 2022 wirksam und mit Zustimmung der ursprünglichen Klägerin, der Y … GmbH, erklärten gewillkürten Parteiwechsel auf Klägerseite ist die hiesige Klägerin zur alleinigen Klägerin des vorliegenden Rechtsstreits geworden.
169
Der Parteiwechsel auf der Klägerseite ist in entsprechender Anwendung des § 263 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG zulässig (vgl. hierzu BGH, Zwischen-Urteil vom 28. Juni 1994 – X ZR 44/93, GRUR 1996, 865). Da der Klägerwechsel vor Beginn der mündlichen Verhandlung erklärt worden ist, ist auch eine Zustimmung der Beklagten entbehrlich (vgl. BGH, Urteil vom 29. August 2012 − XII ZR 154/09, NJW 2012, 3642, Rdnr. 15; MüKo ZPO, 6. Auflage, 2020, § 263, Rdnr. 70 f).
170
Der Parteiwechsel erweist sich zudem als sachdienlich, da sich durch den Wechsel auf Klägerseite der Prozessstoff nicht ändert, die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert und ein weiterer Rechtsstreit vermieden wird (vgl. zu
171
diesen Voraussetzungen BGH, Urteil vom 28. Juni 1994 – X ZR 44/93, veröffentlicht in juris; Zöller, ZPO, 34. Auflage, 2022, § 263, Rdnr. 13).
172
2. Dem stehen Erwägungen zur Zulässigkeit der Klage der jetzigen Klägerin nicht entgegen: Ihre Klage ist auch im Übrigen zulässig.
173
Auch die Rechtskraft des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 7. September 2021 – X ZR 77/19 steht der Zulässigkeit der Klage der neu in den Rechtsstreit eingetretenen Klägerin nicht entgegen. Die … war selbst weder Beteiligte des vorangegangenen Patentnichtigkeitsverfahrens noch ist sie die Rechtsnachfolgerin der dortigen Klägerin. Sie ist also nicht durch § 325 ZPO daran gehindert, eine Patentnichtigkeitsklage auf denselben Klagegrund wie im ersten Patentnichtigkeitsverfahren zu stützen.
174
Darüber hinaus setzt die Ausgestaltung der Patentnichtigkeitsklage als Popularklage der Möglichkeit, einem Kläger den Zutritt zum Nichtigkeitsverfahren aus in seiner Person liegenden Gründen zu versagen, enge Grenzen. Zulässig ist eine solche Klage jedenfalls dann, wenn – wie für die hiesige Klägerin – die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Klägers aus einem von ihm mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent besteht (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2010, X ZR 49/09, BPatGE 51, 308-309, – Ziehmaschinenzugeinheit II, Rn. 8.). Die … wird von der Beklagten vor dem Oberlandesgericht aus dem Streitpatent in Anspruch genommen und verfügt daher über ein ins Gewicht fallendes Eigeninteresse an der Nichtigerklärung des Streitpatents.
175
Angesichts dessen ergeben sich aus der Person der Klägerin oder aus den Beziehungen der Parteien zueinander keine besonderen Umstände, welche die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens gerade zwischen diesen Parteien unter den besonderen Umständen dieses Falles als anstößig oder jedenfalls als dem auch im Prozessrecht zu beachtenden Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) widersprechend erscheinen lassen (vgl. BGH, Urteil vom 7.
176
Oktober 2009, Xa ZR 131/04, m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 3. Dezember 2009 – 10 Ni 8/08, je veröffentlicht in juris):
177
Auch in wirtschaftlicher Hinsicht sind die vormalige und die jetzige Klägerin nicht identisch. Nach dem Parteivortrag hält die jetzige Klägerin einen überwiegenden Anteil, aber nicht sämtliche der Anteile der vormaligen Klägerin. Die jetzige Klägerin agiert nicht als deren „verlängerter Arm“ (vgl. BPatG, Urteil vom 29. Juni 2000 – 2 Ni 13/99 (EU), BPatGE 43, 125-132). Auch schließt ihr Eigeninteresse an der Nichtigerklärung des Streitpatents als Partei des derzeit ausgesetzten Verletzungsverfahrens ein Prozessieren in der Funktion eines bloßen „Strohmanns“ aus (vgl. hierzu näher Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Auflage, 2022, § 81, Rdnr. 100 m. w. N.). Eine Konzernverbundenheit zwischen der jetzigen und der vormaligen Klägerin schafft keine Rechtskraft für oder gegen das am früheren Rechtsstreit nicht beteiligte Unternehmen (vgl. BPatG, Urteil vom 12. November 1981 – 3 Ni 21/81, veröffentlicht in juris). Sie steht der Erhebung einer neuen Patentnichtigkeitsklage durch das am früheren Rechtsstreit nicht beteiligte Unternehmen auch im Übrigen nicht entgegen (vgl. BPatG, Urteil vom 19. Januar 2011 – 5 Ni 103/09 (EU), veröffentlicht in juris). Zu einer „Verwirkung des Klagerechts“ im Patentnichtigkeitsverfahren führt selbst eine enge Konzernverbundenheit mit der früheren Klägerin unter Beachtung des Grundsatzes von Treu und Glauben für eine aktuell Verletzungsbeklagte wie die jetzige Klägerin nicht.
II.
178
1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur endovaskulären Laserbehandlung und insbesondere zur Behandlung von Gefäßerkrankungen, wie z. B. Veneninsuffizienz mit Laserenergie. Unter Verwendung eines optischen Wellenleiters werden Laserstrahlen innerhalb von Blutgefäßen angewandt, insbesondere zur Behandlung von Gefäßkrankheiten, etwa einem venösen Stauungssyndrom (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0001]).
179
Nach der Beschreibung des Streitpatents waren zur Behandlung von erkrankten Gefäßen wie zum Beispiel Krampfadern neben dem Entfernen auch verschiedene Methoden zum Veröden der betroffenen Gefäße bekannt, etwa durch Medikamente, durch Hochfrequenzstrom (radio frequency, RF) oder durch Laserstrahlung (endoluminale Laser-Ablation, ELA). Bei der zuletzt genannten Methode sei nachteilig, dass die mit einer lichtleitenden Faser in das Gefäß geleitete Laserstrahlung nur aus einer kleinen ebenen Endfläche der Faser und nur in Vorwärtsrichtung austrete. Die relativ hohen Energien führten zu stark erhöhten Temperaturen und hierdurch verursachten Schmerzen im umliegenden Gewebe, bei besonders starker thermischer Schädigung auch zu Nervenschädigungen. Zur Schmerzvermeidung würden relativ hohe Konzentrationen von Betäubungsmitteln verabreicht (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0011] bis [0018]).
180
2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die die aufgezeigten Nachteile vermeidet.
181
3. Als zur Problemlösung berufenen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik oder einen Physiker an, der in der Entwicklung von Vorrichtungen für die Behandlung von Körperhohlräumen, insbesondere von Blutgefäßen, mit elektromagnetischer Strahlung erfahren ist und zur Beurteilung medizinischer Aspekte mit einem Arzt zusammenarbeitet. Dieser Fachmann verfügt auch über Kenntnisse der technischen Optik.
182
4. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 7. September 2021 – X ZR 77/19 geltenden Fassung eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:
183
- 0
- A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies, by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device,
comprising - Vorrichtung für die endoluminale Behandlung von venösen Insuffizienzen durch Anwenden von Strahlung auf die Gefäßwand zum Verschließen der Vene beim Zurückziehen der Vorrichtung,
- 1
- a flexible waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) defining an
elongated axis, - mit einem biegsamen Wellenleiter (100, 200, 500, 600, 800, 900), der eine Längsachse bestimmt, mit
- 2
- a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and
- einem optisch mit einer Strahlungsquelle (424) verbindbaren proximalen Ende und
- 3
- a rounded distal end receivable within the blood vessel and
- einem gerundeten von dem Blutgefäß aufnehmbaren distalen Ende,
- 3.1
- including a radiation emitting sur-face (110, 210, 510, 610)
- das eine Strahlung emittierende Oberfläche (110, 210, 510, 610) aufweist,
- 3.1.1
- that emits radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and annularly from the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) onto an angularly extending portion of the surrounding vessel wall,
- die Strahlung von der Strahlungsquelle (424) bezüglich der Längsachse des Wellenleiters (100, 200, 500, 600, 800, 900) in seitliche Richtung und vom Wellenleiter (100, 200, 500, 600, 800, 900) aus ringförmig auf einen sich über einen Winkelbereich erstreckenden Abschnitt der umgebenden Gefäßwand emittiert,
- 3.1.2
- wherein the emitting surface (110, 210, 510, 610) is oriented at an acute angle with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and wherein the emitting surface (110, 210, 510, 610) is substantially conical shaped,
- wobei die Strahlung emittierende Oberfläche (110, 210, 510, 610) in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters (100, 200, 500, 600, 800, 900) angeordnet und die Strahlung emittierende Oberfläche (110, 210, 510, 610) im Wesentlichen kegelförmig ist,
- 4
- the device further comprising
– a cover (106, 206, 506, 606, 906) that - die Vorrichtung umfasst ferner
– eine Abdeckung (106, 206, 506, 606, 906), - 4.1
- is fixedly secured to the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and sealed with respect thereto,
- die am Wellenleiter (100, 200, 500, 600, 800, 900) befestigt und dicht angebracht ist,
- 4.2
- substantially transparent with respect to the emitted radiation
- bezüglich der emittierten Strahlung im Wesentlichen transparent ist,
- 4.3
- that encloses the emitting surface (110, 210, 510, 610) therein, and
- die emittierende Oberfläche (110, 210, 510, 610) einschließt und
- 4.4
- defines a gas-waveguide interface that refracts emitted radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) onto the surrounding vessel wall
- eine Gas-Wellenleiterschnittstelle bildet, die emittierte Strahlung bezüglich der Längsachse des Wellenleiters (100, 200, 500, 600, 800, 900) in seitliche Richtung auf die umgebende Gefäßwand bricht
- 5a
- – at least one laser source (424) that provides laser radiation of 1470 nm +/- 30 nm or 1950 nm +/- 30 nm, wherein the proximal end of the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) is optically coupled to the at least one laser source (424).
- – mindestens eine Laserquelle (424), die Laserstrahlung mit einer Wellenlänge von 1470 nm +/- 30 nm oder 1950 nm +/- 30 nm aussendet und mit der das proximale Ende des Wellenleiters (100, 200, 500, 600, 800, 900) optisch gekoppelt ist.
184
5. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung (vgl. zu den folgenden Ausführungen a) bis g) BGH, Urteil vom 7. September 2021 – X ZR 77/19, Rn. 11 ff.).
185
a) Die Zweckangabe in
Merkmal 0 beschränkt den geschützten Gegenstand nicht auf den Einsatz bei einer endoluminalen Behandlung einer venösen Insuffizienz durch Anwenden von Strahlung auf die Gefäßwand zum Verschließen der Vene beim Zurückziehen der Vorrichtung.
186
Zweck- und Funktionsangaben in einem Sachanspruch beschränken dessen Gegenstand regelmäßig nicht auf den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion. Sie haben grundsätzlich nur zur Folge, dass der geschützte Gegenstand objektiv geeignet sein muss, den angegebenen Zweck oder die angegebene Funktion zu erfüllen. Nicht erforderlich ist, dass der Gegenstand tatsächlich für diesen Zweck eingesetzt wird oder für einen solchen Einsatz bestimmt ist (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 24. April 2018 – X ZR 50/16, GRUR 2018, 1128 Rn. 12 – Gurtstraffer).
187
Sofern die Eignung für den angegebenen Zweck voraussetzt, dass einzelne Betriebsparameter wie etwa die Wellenlänge oder die Energie der Laserstrahlung innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, genügt es grundsätzlich, wenn die Vorrichtung die Möglichkeit bietet, diese Parameter entsprechend einzustellen. Sofern diese Voraussetzung vorliegt, ist es grundsätzlich unerheblich, ob der Hersteller oder Lieferant diese Einstellungen empfiehlt oder ein Nutzer sie üblicherweise auswählt (vgl. BGH, Urteil vom 13. Dezember 2005 – X ZR 14/02, GRUR 2006, 399 Rn. 21 – Rangierkatze).
188
b) Aus der Zweckangabe in
Merkmal 0 ergeben sich folgende Anforderungen an die räumlich-körperliche Ausgestaltung der durch die geltende Fassung geschützten Vorrichtung:
189
aa) Der Durchmesser muss so beschaffen sein, dass die Vorrichtung in eine Vene eingeführt und in dieser zurückgezogen werden kann.
190
Hieraus ergeben sich keine exakten Ober- und Untergrenzen, weil Venen unterschiedliche Durchmesser aufweisen können. Die im Streitpatent als bevorzugt angegebenen Werte von 1235 bis 1365 µm für den Wellenleiter und 1800 bis 2000 µm für die Abdeckung (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0059], Z. 9 – 13) – die im geltenden Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden haben – können deshalb zwar als Anhaltspunkt für eine geeignete Größe herangezogen werden, stellen aber keine starren Bereichsgrenzen dar.
191
bb) Zur Wandstärke einer die Faserspitze schützenden Abdeckung können den Merkmalen des Patentanspruchs keine exakten Ober- oder Untergrenzen entnommen werden, zumal die Stabilität nicht allein von der Wandstärke, sondern auch vom eingesetzten Material abhängt.
192
cc) Der Abstand zwischen dem Ende der Faser und dem Ende der Abdeckung ist in Patentanspruch 1 nicht vorgegeben.
193
dd) Die Form der beanspruchten Vorrichtung insgesamt muss so gestaltet sein, dass sie geeignet ist, in das Lumen einer Vene eingeführt und in diesem zurückgezogen zu werden. Dies schließt scharfe Kanten oder zur Perforation von Venen geeignete Spitzen aus. Gemäß
Merkmal 3 weist die Vorrichtung nunmehr explizit ein gerundetes, von dem Blutgefäß aufnehmbares distales Ende auf.
194
ee) Die Form der Abdeckung im Sinne des
Merkmals 4 folgt dieser Maßgabe. Die Abdeckung muss so beschaffen sein, dass sie bei der Behandlung nicht zu intolerablen Funktionsbeeinträchtigungen oder Verletzungen der Gefäße führt. Sie befindet sich am distalen Ende der Vorrichtung. Hieraus ergibt sich eine in irgendeiner Weise ausgestaltete, abgerundete Form der Abdeckung. Da der Verlauf der zu verödenden Venen kurvig ist und die Vorrichtung diesem Verlauf beim Einbringen vor der Behandlung folgt, ist eine gewisse Flexibilität der Vorrichtung erforderlich. Bei einer starren Abdeckung beispielsweise aus Quarzglas (vgl. Streitpatentschrift, erstes Ausführungsbeispiel,
quartz cap (106)) limitiert dieses Erfordernis die axiale Länge der Abdeckung.
195
c) Die beanspruchte Vorrichtung umfasst einen biegsamen Wellenleiter (100, 200, 500, 600, 800, 900), der eine Längsachse beinhaltet und damit auch definiert, mit einem optisch mit einer Strahlungsquelle (424) verbindbaren proximalen Ende (
Merkmale 1 und 2). In der Figur 1 der Patentschrift ist ein solcher Wellenleiter als Ausführungsbeispiel dargestellt. Figur 2 zeigt dazu einen Wellenleiter im Zusammenhang mit einem Gewebe (target tissue 214) eines zu behandelnden Blutgefäßes (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0040]). Unter einem Wellenleiter (wave guide) versteht der Fachmann eine sogenannte optische Faser (optical fibre) (vgl. Streitpatentschrift, Anspruch 10).
196
d) Ein stufenfreier Übergang zwischen dem proximalen Ende der Kappe und dem Wellenleiter ist in Patentanspruch 1 nicht zwingend vorgesehen.
197
Den Darlegungen in der Beschreibung des Streitpatents, wonach eine gleichmäßige Geschwindigkeit beim Zurückziehen der Laserfaser wichtig sei, um Überhitzungen zu vermeiden (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0019] und [0048]), lässt sich nicht entnehmen, dass dieses Ziel nur mit einem stufenfreien Übergang zu erreichen ist. Eine solche Annahme stünde zudem in Widerspruch zu dem in den Figuren 1a und 1b dargestellten Ausführungsbeispiel. Anhaltspunkte dafür, dass diese Ausführungsform nicht zum Gegenstand von Patentanspruch 1 gehören soll, lassen sich der Patentschrift nicht entnehmen.
198
e) Der biegsame Wellenleiter (100, 200, 500, 600, 800, 900) weist gemäß
Merkmal 3 /
Merkmal 3.1 ein von einem Blutgefäß aufnehmbares distales Ende auf, welches über eine Oberfläche (110, 210, 510, 610) verfügt, die Strahlung emittiert (vgl. Fig. 1 und 2). Die Abstrahlcharakteristik ist in den
Merkmalen 3.1.1 und
3.1.2 näher festgelegt.
199
aa) Die Strahlung muss unter anderem so beschaffen sein, dass intolerable Verletzungen der Gefäße vermieden werden. Hieraus lassen sich keine starren Grenzen für die Leistungsdichte oder die Größe der bestrahlten Fläche ableiten.
200
bb) Zentrale Bedeutung kommt der in
Merkmal 3.1.1 vorgesehenen Voraussetzung zu, die Laserstrahlung in seitlicher Richtung ringförmig zu emittieren, so dass sie auf einen sich über einen Winkelbereich erstreckenden Abschnitt der umgebenden Gefäßwand trifft.
201
Diese Wirkung wird nach
Merkmal 3.1.1 durch eine entsprechende Ausgestaltung oder Anpassung der die Strahlung emittierenden Oberfläche des Wellenleiters erzielt.
202
Die Oberfläche des Wellenleiters muss also aufgrund ihrer Form oder sonstiger Eigenschaften so ausgebildet sein, dass jedenfalls ein Teil der Strahlung in seitliche Richtung ringförmig austritt. Damit sind Ausführungsformen ausgeschlossen, bei denen die Oberfläche der Faser so beschaffen ist, dass die Strahlung nur an einer Endfläche austreten kann, die eine zur Längsachse der Faser senkrecht stehende Ebene bildet.
203
Dieses Verständnis wird bestätigt durch die in der Beschreibung des Streitpatents enthaltenen Ausführungen zum Stand der Technik. Dort werden bekannte Vorrichtungen unter anderem deshalb als nachteilig eingestuft, weil die Strahlung nur durch die kleine flache Stirnseite an der Spitze der Faser austreten könne (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0016], Z. 53 – 56; Abs. [0020], Z. 55 – 58). Wenn
Merkmal 3.1.1 vor diesem Hintergrund festlegt, dass die Oberfläche des Wellenleiters am distalen Ende eingerichtet sein muss, um Strahlung in seitliche Richtung zu emittieren, ist dies so zu verstehen, dass es einer besonderen Ausgestaltung dieser Oberfläche bedarf, die über eine stumpfe / flache Endfläche hinausgeht.
204
cc) Nach
Merkmal 3.1.2 muss die Strahlung emittierende Oberfläche in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters angeordnet und im Wesentlichen kegelförmig sein.
205
f) Gemäß der
Merkmalsgruppe 4 weist die Vorrichtung zudem eine Abdeckung (106, 206, 506, 606, 906) auf, die am Wellenleiter (100, 200, 500, 600, 800, 900) befestigt / dicht angebracht (
Merkmal 4.1) und dabei bezüglich der emittierten Strahlung im Wesentlichen transparent ist (
Merkmal 4.2).
206
aa) Durch die Abdeckung ist am distalen Ende der Faser ein Gas eingeschlossen, so dass sich gemäß
Merkmal 4.4 beim Austritt der Strahlung aus der Faser eine definierte Gas-Wellenleiterschnittstelle mit konstantem Brechungsindexsprung bildet. Durch diesen wird die aus dem Wellenleiter austretende Strahlung bezüglich der Längsachse des Wellenleiters in seitliche Richtung auf die umgebende Gefäßwand gebrochen.
207
Im Ergebnis wird die gewünschte Strahlrichtung damit weder allein durch die Ausgestaltung der Oberfläche nach
Merkmal 3.1.1 noch allein durch eine Brechungswirkung nach
Merkmal 4.4. erzielt, sondern durch die Kombination und das Zusammenwirken dieser beiden Mittel.
208
bb) Dies steht auch in Einklang mit den in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispielen.
209
(1) Beim ersten Ausführungsbeispiel, das in den oben wiedergegebenen Figuren 1a und 1b dargestellt ist, weist der Wellenleiter ein konisch geformtes Ende (110) auf, das von einer aus Quarz bestehenden Kappe (106) umgeben ist. Die Quarzkappe (106) ist mit Luft oder Gas befüllt und weist zudem eine konisch geformte reflektierende Oberfläche (112) auf. Aufgrund des Winkels der Oberfläche (110) und der unterschiedlichen Brechungsindizes wird die Strahlung radial und ringförmig emittiert (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0042]).
210
(2) Bei einem anderen Ausführungsbeispiel, das in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 5 dargestellt ist, wird die seitlich bestrahlte Fläche der Gefäßwand durch die konisch geformte Spitze und eine Vielzahl von weiteren emittierenden Oberflächen erzeugt. Hierzu ist das Ende des Wellenleiters (500) mit einem Abschnitt (504) verbunden, der mehrere Rillen aufweist, um das gewünschte Strahlungsprofil zu erzeugen.
211
(3) Bei einem weiteren, in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 7a und 7b dargestellten Ausführungsbeispiel ist am Ende des Wellenleiters (740) ein reflektierender Kegel (742) angebracht (Streitpatentschrift, Abs. [0053]).
212
(4) Bei einem ähnlichen, in den Figuren 8a und 8b dargestellten Ausführungsbeispiel wird die Reflexionswirkung durch einen mit Luft oder Gas gefüllten, reflektierenden Zwischenraum (844) erzielt, der sich zwischen dem konvex ausgeformten Ende des Wellenleiterkerns (840) und einer gegenüberliegenden konkav ausgeformten Oberfläche erstreckt (Streitpatentschrift, Abs. [0054]).
213
(5) Diesen Ausführungsbeispielen ist gemeinsam, dass das Ende des Wellenleiters in besonderer Weise geformt ist, um den Austritt der Strahlung in der gewünschten Richtung zu ermöglichen (vgl.
Merkmal 3.3.1). Nach dem Austritt aus dem Wellenleiter wird der Lichtstrahl durch den Brechungsindexsprung an der Gas-Wellenleiterschnittstelle zusätzlich umlenkt (vgl.
Merkmal 4.4)
.
214
cc) All dies schließt nicht aus, dass die Strahlungsrichtung zusätzlich durch weitere Maßnahmen (z.B. Anordnung eines Reflektors in der Kappe) beeinflusst wird.
215
g) Eine feste und dichte Anbringung der Abdeckung an den Wellenleiter im Sinne von
Merkmal 4.1 erfordert, dass die Abdeckung sich beim Zurückziehen der Vorrichtung aus der Vene nicht vom Wellenleiter löst. Zudem muss das Eindringen von Flüssigkeit während der Behandlung verhindert werden, da sich andernfalls beim Faseraustritt ein anderes Brechungsindexverhältnis und folglich eine andere Emissionsrichtung einstellt. Die Anbringung der Abdeckung muss derart dicht sein, dass der angestrebte Behandlungserfolg nicht durch eindringende Flüssigkeiten beeinträchtigt wird.
216
Den Ausführungen zum ersten Ausführungsbeispiel, in denen von einer hermetischen Abdichtung die Rede ist (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0042], Z. 31 – 36), sind keine weitergehenden Anforderungen zu entnehmen. An allen anderen Stellen der Streitpatentschrift wird nur eine Abdichtung erwähnt. Weitergehende Anforderungen, wie beispielsweise der Grad der Dichtheit, lassen sich dem Begriff „hermetisch“ im Zusammenhang mit dem Streitpatent daher nicht entnehmen. Er ist deshalb anhand der Funktion auszulegen, die der Abdichtung nach dem Streitpatent zukommt. Wie dargelegt, besteht diese Funktion im Zurückhalten von eindringender Flüssigkeit, und zwar dergestalt, dass die optische Wirkung der Vorrichtung nicht beeinträchtigt wird.
217
h) Nach
Merkmal 5a weist die Vorrichtung mindestens eine Laserquelle (424) auf, die Laserstrahlung mit einer Wellenlänge von 1470 nm ± 30 nm oder 1950 nm ± 30 nm im nahen Infrarotbereich (NIR) aussendet und mit der das proximale Ende des Wellenleiters (100, 200, 500, 600, 800, 900) optisch gekoppelt ist.
218
Ein Vorteil der Wellenlängen 1470 nm und 1950 nm besteht gemäß der Beschreibung des Streitpatents darin, dass sie in Wasser viel stärker absorbiert werden als in Hämoglobin oder Oxyhämoglobin. Folglich würden solche Wellenlängen im Wesentlichen vollständig im Gefäßwandgewebe absorbiert und erleichterten so den Verschluss von Blutgefäßen durch die Strahlungseinwirkung (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0062]).
219
In der Beschreibung des Streitpatents werden außerdem mögliche Ausführungsformen mit Wellenlängen von etwa 810 nm, etwa 940 nm, etwa 1064 nm, etwa 1320 nm, etwa 2100 nm, etwa 3000 nm und etwa 10000 nm genannt, die allerdings nicht in
Merkmal 5a aufgeführt und somit auch nicht von Anspruch 1 umfasst sind.
III.
220
In der geltenden Fassung hat das Streitpatent keinen Bestand. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist in dieser Fassung gegenüber dem sich im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ).
221
1. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht für den Fachmann ausgehend vom Offenbarungsgehalt der Druckschrift
N76 in Verbindung mit der Druckschrift
N31A nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
222
a) Im Abstract Nr. 100 der Anlage
N76 wird auf den Einsatz von radial abstrahlenden Lichtwellenleitern als eine Möglichkeit zur Optimierung der endoluminalen Laserbehandlung der Stammveneninsuffizienz in Abhängigkeit von der verwendeten Wellenlänge, der Energiedichte und des Intravasalmediums hingewiesen.
223
Die Druckschrift N76 enthält Kurzzusammenfassungen zu einzelnen Vorträgen aus dem Programm der Dreiländertagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie, die vom 5. bis 8. September 2007 in Basel stattfand. Abstract Nr. 100, C. Burgmeier et. al., S. 307, stellt die Ergebnisse verschiedener Experimente vor, die an einem etablierten Ex-vivo-Rinderfußmodell zur Untersuchung der Einflüsse des verwendeten Lichtwellenleiters, der Laserwellenlänge und der Energiedichte zur endoluminalen Laserbehandlung der Varikosis durchgeführt wurden. Die präparierte Vena saphena lateralis wurde dazu unter Verwendung von Diodenlasern der Wellenlängen 980 und 1470 nm laserbehandelt. Die Lichtenergie wurde mithilfe einer „bare fiber“ und verschiedenen radial abstrahlenden Lichtwellenleitern endoluminal appliziert. Im Falle der Laser-Wellenlänge 1470 nm wurden Laserleistungen zwischen 5 und 20 W verwendet. Beurteilt wurden die für den Erfolg der Behandlung notwendigen Koagulationseffekte, unerwünschte Gewebeschädigungen im Sinne von Perforationen, Carbonisationen und Perivasalschäden sowie das Handling mit der Laserfaser. Die nach den Ergebnissen bevorzugt zu verwendenden Radialstrahler führten zu einer homogenen zirkulären Schädigung, ohne Perforationseffekte (Löcher in der Venenwand) hervorzurufen.
224
Die N76 offenbart somit eine Vorrichtung im Sinne des
Merkmals 0, wobei der Fachmann mitliest, dass es sich bei dem Lichtwellenleiter der Vorrichtung um einen biegsamen Wellenleiter handelt, welcher eine Längsachse entsprechend dem
Merkmal 1 aufweist.
225
Da eine Perforation der Venenwand zu vermeiden ist, ist das distale Ende der Vorrichtung, welches von dem Blutgefäß aufgenommen und in ihm vor- und zurückgeschoben werden soll, zwingend dem
Merkmal 3 entsprechend als gerundetes Ende auszugestalten.
226
Für eine radiale Abstrahlung des Lichtwellenleiters ist dessen proximales Ende im Sinne des
Merkmals 2 optisch mit einer Strahlungsquelle verbunden, wobei es sich entsprechend dem
Merkmal 5a um ein „
1470 nm-Lasergerät“ mit der Wellenlänge 1470 nm handelt.
227
Zudem weist der „
radial abstrahlende Lichtwellenleiter“ eine Strahlung emittierende Oberfläche im Sinne des
Merkmals 3.1 auf, welche die Strahlung von der Längsachse des Wellenleiters in seitliche Richtung emittiert. Bei einer „
homogenen zirkulären Schädigung“ liest der Fachmann einen sich ringförmig auf einen sich über einen Winkelbereich erstreckenden, bestrahlten Abschnitt der umgebenden Gefäßwand nach
Merkmal 3.1.1 mit. Ein Diffusor, der Laserlicht ungerichtet in alle Raumrichtungen ausstrahlt, wird demnach nicht verwendet.
228
Die N76 stellt Verödungsversuche, die mit einer „
bare fiber“, einem blanken, distalen Faserende ohne Abdeckung, durchgeführt wurden, Verödungsversuchen gegenüber, die mit Radialstrahlern, also mit Fasern ohne blankes Faserende durchgeführt wurden. Dieser Gegenüberstellung entnimmt der Fachmann der N76, dass die Radialstrahler im Unterschied zur ebenfalls beschriebenen „
bare fiber“ über eine Abdeckung
im Sinne desMerkmals 4 verfügen, welche das distale Faserende umgibt und für Strahlung im Wesentlichen transparent sein muss. Diese Ausgestaltung entspricht den
Merkmalen 4.2 und
4.3.
229
Durch das Einschließen der emittierenden Oberfläche bildet die Abdeckung eine Gas-Wellenleiterschnittstelle an der Austrittsfläche des Laserlichts aus der Faser, die die emittierte Strahlung bezüglich der Längsachse des Wellenleiters in seitliche Richtung auf die umgebende Gefäßwand bricht (
Merkmale 4.3 und 4.4). Zur Verwendung einer definierten Gas-Wellenleiterschnittstelle ist eine dichte und sichere Befestigung der Abdichtung nach
Merkmal 4.1 notwendig. Sie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und trägt so zugleich einer hygienisch sicheren, medizinischen Verwendung Rechnung.
230
Weitere Anhaltspunkte zur konkreten Ausgestaltung des distalen Endes des Radialstrahlers vermag der Fachmann der N76 nicht zu entnehmen. Unmittelbar und eindeutig ist nicht offenbart, dass die Strahlung emittierende Oberfläche in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters angeordnet und die Strahlung emittierende Oberfläche im Wesentlichen kegelförmig ist (
Merkmal 3.1.2).
231
Zur konkreten Ausgestaltung des distalen Endes der radial abstrahlenden Lichtwellenleiter-Vorrichtung war der nacharbeitende Fachmann daher – von der N76 ausgehend – veranlasst, sich bezüglich des distalen Endes im Stand der Technik umsehen.
232
Eine Ausgestaltung eines radial abstrahlenden Lichtwellenleiters entnahm der Fachmann der vorveröffentlichten Druckschrift
N31 (inhaltsgleich zur
N31A). Die N31 offenbart dem Fachmann Einzelheiten zur Erzeugung von radial emittierter Strahlung im nahen Infrarotbereich (NIR) mittels eines radial abstrahlenden, flexiblen Wellenleiters in hohlen Organen.
233
Die N31 befasst sich mit einer vergleichbaren Aufgabenstellung wie die N76, nämlich mit dem Koagulieren von Gewebe unter Vermeidung von Perforation, Karbonisationen und Perivasalschädigungen. Anhand von vier Anwendungsbeispielen wird die Anwendung von Licht mit flexiblen Lichtleitern in hohlen Organen beschrieben (vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen zum Offenbarungsgehalt dieser Entgegenhaltung (dort N31A) BGH, Urteil vom 7. September 2021 – X ZR 77/19, Rn. 52 ff). Die Entgegenhaltung N31 erläutert, dass für diese Zwecke eingesetzte Fasern nicht nur ausreichend Energie übertragen sollten, sondern auch Abstrahlcharakteristiken zeigen, die die Behandlung effektiv, sicher und berechenbar machten. Dies könne erreicht werden, indem die Fasern entsprechend den gewünschten Wechselwirkungen zwischen Licht und Gewebe und den geometrischen und anatomischen Beschränkungen modifiziert würden (vgl. S. 304, Kap. 1, Abs. 1).
234
Als mögliche Anwendungsszenarien werden die Koagulation in axialer Richtung mit kleinem Bestrahlungsabstand, die umfänglich vollständige Koagulation von Fisteln zwischen Speise- und Luftröhre (ösophagotracheal) bei Neugeborenen, die homogene Bestrahlung von zylindrischen Organen und die isotrope Bestrahlung der gesamten Blasenwand geschildert (vgl. S. 304, Kap. 1, Abs. 2).
235
Der endoskopische Verschluss von ösophagotrachealen Fisteln wird als neue und vielversprechende Technik geschildert. Hierfür stünden zwei konträre Methoden zur Verfügung, nämlich die axiale bzw. tangentiale Lichtführung mittels Fasern mit flachem Faserende bei einem Divergenzwinkel von weniger als 30° und maximaler Lichtintensität in Vorwärtsrichtung und die radiale Lichtanwendung mittels konischer Faserspitzen bei einem Divergenzwinkel von mehr als 90° und einem allenfalls minimalen Lichtanteil, der in Vorwärtsrichtung abgestrahlt wird (vgl. S. 306, Kap. 2.2, Abs. 2).
236
Um die Lichtanwendung zu optimieren, sei die Speiseröhre von Ratten als Fistelmodell verwendet worden.
237
In den Versuchen habe die axiale Bestrahlung zu Perforationen oder einer unzulänglichen Koagulation geführt. Beide Effekte seien unvorhersehbar aufgetreten. Ursache dafür sei die nicht-koaxiale Positionierung der Faser in der Speiseröhre (vgl. S. 306, Kap. 2.2, Abs. 3).
238
Da die koaxiale Positionierung der Faser in einer ösophagotrachialen Fistel noch schwieriger erscheine als in der Speiseröhre einer Ratte, sei eine Lasersonde mit radialer Abstrahlung hergestellt worden, die geringere Anforderungen an die Positionierung stelle. Der Aufbau einer solchen Sonde ist in Figur 3 schematisch dargestellt:
239
Als geeigneter Wert für den Außendurchmesser wird ein Bereich zwischen 500 µm und 2 mm angegeben (vgl. S. 306, Kap. 2.2, Abs. 4). In den abschließend aufgezeigten Schlussfolgerungen wird ergänzend ausgeführt, dass der Durchmesser der Sonde auf mindestens zwei Drittel des Fisteldurchmessers angepasst werden müsse, um eine Zerstörung im Falle des Gewebekontakts zu vermeiden (vgl. S. 311, Kap. 3, Abs. 2).
240
Der mit einer solchen Vorrichtung erzeugte Strahl könne als Hohlkegel bezeichnet werden, dessen Wandstärke mit dem Abstand zur Faserspitze zunehme (vgl. S. 306, Kap. 2.2, Abs. 4).
241
Die N31 lehrt somit, dass radial emittierte Strahlung mit Hilfe einer Laser-/ Sonden-Vorrichtung (
radial / radially radiating laser probe) erzeugt wird, welche neben den
Merkmalen 1 und
2 die
Merkmale 3 und
3.1.1 sowie das
Merkmal 4 des Streitpatents aufweist (vgl. Fig. 3, Fig. 4 und 5 mitsamt zugehörigem Text, S. 304, Kap. 1, Abs. 1, sowie S. 306, Kap. 2.2, Abs. 2 bis 4, und S. 311, Kap. 3, Abs. 2).
242
Dazu wird nach der Lehre der Druckschrift N31 ein biegsamer – eine Längsachse definierender – koaxialer Wellenleiter (
flexible light guide(s) / coaxial fiber) eingesetzt, der mit einem optisch mit einer Strahlungsquelle (
laser) verbindbaren, proximalen Ende sowie einem gerundeten und damit von dem Gefäß ohne Verletzungsgefahr aufnehmbaren distalen Ende (
distal end) ausgestattet ist, welches eine Strahlung emittierende Oberfläche aufweist (vgl. a. a. O., insbes. Kap. 2.2, Abs. 1 und 4 sowie Fig. 3 /
Merkmale 1 bis
3 und
3.1). Entsprechend
Merkmal 3.1.1 ist die Vorrichtung dazu eingerichtet, Strahlung von der Strahlungsquelle (
laser) bezüglich der Längsachse des Wellenleiters radial (
radially) und damit in seitliche Richtung und vom Wellenleiter aus ringförmig auf einen sich über einen Winkelbereich erstreckenden Abschnitt der umgebenden Gefäßwand zu emittieren (vgl. Fig. 3 und 4 mitsamt zugehörigem Text).
243
Die Strahlung emittierende Oberfläche des Wellenleiters ist konisch / kegelförmig geformt (
conical distal end) und in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters (
coaxial fiber) angeordnet (vgl. Fig. 3 und den Text S. 306 in Kap. 2.2, Abs. 4 /
Merkmal 3.1.2).
244
Weiterhin offenbart die Druckschrift N31 eine am Wellenleiter befestigte, dicht angebrachte Abdeckung aus – offensichtlich für die Strahlung transparentem – Quarzglas (
fused silica), wobei die Abdeckung aus Quarzglas die emittierende Oberfläche des Wellenleiters einschließt (vgl. Fig. 3 mitsamt zugehörigem Text in Kap. 2.2, Abs. 4 /
Merkmale 4,
4.1 bis
4.3). Hier wird in Kombination mit der konischen Oberflächengeometrie des Wellenleiterendes eine refraktive Schnittstelle durch den Übergang vom Wellenleiterkern zu Gas oder Luft (
fiber core /
air) gebildet, die dann – wie vorstehend dargelegt – die emittierte Strahlung mit einer NIR-Wellenlänge entsprechend
Merkmal 4.4 in seitliche Richtung auf die umgebende Gefäßwand bricht (vgl. N31 a. a. O.).
245
Wie der Fachmann erkennt, sprechen Größe und Durchmesser der Vorrichtung (vgl. S. 306, Kap. 2,2 Abs. 4:
outer diameter range between 500 nm und 2 mm) sowie die Formgebung der abgerundeten Kappe für ihre Eignung zur Venenverödung.
246
Die in der N31 beschriebenen, zum Einsatz in hohlen Organen bestimmten flexiblen Lichtleiter sollen ebenfalls ausreichend Energie übertragen können und Abstrahlcharakteristiken zeigen, die die Behandlung effektiv, sicher und berechenbar machen. Nach der Lehre der N31 kann dies erreicht werden, indem die Fasern entsprechend den gewünschten Wechselwirkungen zwischen Licht und Gewebe und den geometrischen und anatomischen Beschränkungen modifiziert werden (S. 304, Kap. 1, Abs. 1).
247
Auf der Suche nach einem Vorbild für eine konkrete Ausbildung des distalen Endes der in
N76 genannten radial abstrahlenden Wellenleiter-Vorrichtung für den NIR-Wellenlängenbereich bei 1470 nm zur Venenverödung gelangte der Fachmann damit in Kenntnis der Lehre der Druckschrift
N31 in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 der geltenden Fassung mit sämtlichen
Merkmalen 0 bis
5a.
248
Dass in der N31 beispielhaft eine alternative Wellenlänge von 1320 nm, eine Leistung von 5 Watt und eine Dauer von 8 Sekunden als Parameter für die Bestrahlung angegeben werden, hielt den Fachmann nicht davon ab, für den in der N76 zur Venenverödung genannten NIR-Wellenlängenbereich bei 1470 nm und die dort bezeichnete, radial abstrahlende Wellenleiter-Vorrichtung auf die Ausgestaltung des distalen Endes nach dem Vorbild der N31 zurückzugreifen. Die Ausgestaltung eines Radialstrahlers, bei welchem die Strahlung emittierende Oberfläche in einem – anspruchsgemäß nicht näher definierten – spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters angeordnet und die Strahlung emittierende Oberfläche im Wesentlichen kegelförmig ist (
Merkmal 3.1.2), eignet sich nämlich für die Verwendung von Lichtleitern mit unterschiedlichen Wellenlängen, von denen die
N31 selbst mehrere benennt (vgl. S. 306, vorletzter Absatz:
Wavelenghts used were 488/514 nm, 1,06 µm and 1,32 µm). Der Fachmann erkennt hier, dass diese Ausgestaltung des distalen Endes nicht nur für eine einzige bestimmte Wellenlänge im nahen Infrarotbereich (NIR), sondern auch für eine Wellenleiter-Vorrichtung für den NIR-Wellenlängenbereich bei 1470 nm geeignet ist.
249
In der geltenden Fassung ist der Patentanspruch 1 des Streitpatents damit nicht patentfähig.
250
2. Nach Erörterung dieser Frage in der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte erklärt, dass sie das Streitpatent in seiner geltenden Fassung und in den Fassungen der Hilfsanträge jeweils als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt (vgl. hierzu näher BGH, Urteil vom 13. September 2016 – X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 –; Datengenerator). Dem Begehren der Beklagten entsprechend sind nachfolgend die hilfsweise verteidigten Fassungen des Streitpatents in antragsgemäßer Reihenfolge zu prüfen, nachdem sich der geltende unabhängige Patentanspruch 1 als nicht rechtsbeständig erweist; in seiner geltenden Fassung hat das Streitpatent somit insgesamt keinen Bestand.
IV.
251
In den Fassungen der
Hilfsanträge I bis X vom 10. November 2023 vermag die Beklagte das Streitpatent ebenfalls nicht erfolgreich zu verteidigen. Der jeweilige Gegenstand ihres Patentanspruchs 1 beruht ausgehend von der Veröffentlichung
N76 in Verbindung mit dem Offenbarungsgehalt der Druckschrift
N31 gleichermaßen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPÜ). Ein Fachmann, der die Vorrichtung zur Venenverödung der N76 mit dem dort erfolgreich eingesetzten Radialstrahler nacharbeitet, zieht zur baulichen Ausgestaltung des distalen Endes der Vorrichtung die N31 hinzu. Ausgehend von diesem gemeinsamen Ausgangspunkt erweisen sich die Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 in den Fassungen der Hilfsanträge I bis X in ihren nachfolgend erörterten Modifikationen ebenfalls als nicht patentfähig:
252
1. In der Fassung des
Hilfsantrags I wird die Eigenschaft „dicht“ innerhalb des
Merkmals 4.1HI des Patentanspruchs 1 mit „hermetisch dicht“ spezifiziert.
253
M4.1HI and
hermetically sealed with respect thereto,
254
Wie ausgeführt, lassen sich dem Begriff „hermetisch“ keine weitergehenden Anforderungen, etwa zum Grad der Dichtheit, entnehmen. Ihrer Funktion entsprechend soll die streitpatentgemäße Abdeckung das Eindringen von Flüssigkeit verhindern und die Luft in der Abdeckung zurückhalten, so dass der gewünschte optische Übergang zwischen distaler Faseroberfläche und Luft an der Austrittsstelle der Strahlung aus dem Lichtwellenleiter erhalten bleibt („gas-waveguide interface“).
255
Die Druckschrift N31 zeigt eine Abdeckung (
fused silica tube), welche diese Funktion wahrnimmt, dicht und sicher am Wellenleiter befestigt ist (vgl. Fig. 3) und somit auch das in der Fassung des Hilfsantrags I geänderte
Merkmal 4.1HI mit dem Zusatz „hermetisch“ offenbart.
256
Auch das
Merkmal 4.1HI ist damit nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen (vgl. die Ausführungen zu den weiteren Anspruchsmerkmalen unter Ziffer III, die hier in gleicher Weise gelten).
257
2. Die Fassung des
Hilfsantrags II unterscheidet sich von der geltenden Fassung des Patentanspruchs 1 dadurch, dass am Ende zusätzlich das
Merkmal 6HII aufgenommen worden ist, wonach die Aufweitung des ringförmigen Strahls durch einen Winkel bestimmt ist, der im Bereich zwischen etwa 30° und 40° liegt:
258
M6HIIwherein the spread of the annular beam is defined by an angle within the range of about 30° to about 40°, and
259
a) Auf welche Weise dieser in Abs. [0042] offenbarte Aufweitungswinkel von in etwa 30° bis in etwa 40° erzeugt wird, ist dem Streitpatent nicht zu entnehmen. Das Streitpatent verbindet mit einem Bereich von 30° bis 40° für die axiale Aufweitung der ringförmigen Abstrahlung (vgl. Abs. [0042] Z. 47-56) keine besonderen Vorteile. Es wird lediglich – und insoweit in sinngemäßer Übereinstimmung mit der Veröffentlichung N31 (vgl. S. 305, linke Sp., vorletzter und letzter Absatz) – darauf hingewiesen, dass ein Vorteil dieser Konfiguration gegenüber der aus dem Stand der Technik bekannten in axialer Richtung abstrahlenden Faser mit flachem Faserende (flat bare tipped fiber) eine im Wesentlichen radiale Abstrahlung sei, wodurch die Strahlung direkter und effizienter in die Gefäßwand eingebracht werden könne. Außerdem könne durch Einstellen der Abstrahlcharakteristik die Länge des behandelten ringförmigen Gefäßbereiches sowie die Verteilung der Leistungsdichte entlang dieser Länge variiert werden (vgl. Abs. [0043], Z. 57 bis Z. 12; vgl. hierzu BPatG, Urteil vom 12. März 2019 – 4 Ni 60/17 (EP), S. 42, zweiter Absatz, veröffentlicht in juris).
260
b) Eine Ausgestaltung, bei welcher die Aufweitung der ringförmigen Strahlung in einem Bereich von rund 30° bis rund 40° liegt, ist dem Fachmann durch die Zusammenfassung Nr. 100 des wissenschaftlichen Vortrags der
N76 in Verbindung mit der Lehre der Druckschrift
N31 nahegelegt.
261
aa) In beiden Schriften ist dieser nun ergänzend beanspruchte Aufweitungswinkel nicht angegeben.
262
Der N76 entnimmt der Fachmann, dass mit einem Radialstrahler unter Verwendung der Wellenlänge 1470 nm, welche direkt von der Venenwand und nicht vom Blut absorbiert wird, eine homogene zirkuläre Schädigung der Venenwand ohne Perforationseffekte hervorgerufen werden kann (vgl. N76,
Ergebnisse: Die Radialstrahler führten hingegen zu einer homogenen zirkulären Schädigung ohne Perforationseffekte hervorzurufen.). Eine homogene Schädigung der Venenwand bedingt eine über die zu behandelnde Fläche homogene Energiedichte (Energie pro Flächeneinheit). Größere – in der N76 nicht näher spezifizierte – Aufweitungswinkel entsprechen bei homogener Bestrahlung größeren Bestrahlungsflächen. Für den Einsatz am Patienten haben größere Bestrahlungsflächen den Vorteil, dass sich Unregelmäßigkeiten im Rückzug weniger stark auf das Behandlungsergebnis auswirken.
263
Als weitere Angaben zur Energiedichte sind der Druckschrift nur die verschiedenen, in der N76 genannten Laserleistungen zu entnehmen. Zur momentan bestrahlten Fläche und zu weiteren Eigenschaften des verwendeten Lichtwellenleiters enthält die Druckschrift keine Angaben.
264
Für den in der N31 gezeigten Radialstrahler mit einem spitzen Konuswinkel von 58° ist beispielhaft eine radiale Abstrahlcharakteristik gezeigt (vgl. Fig. 4 und 5), Die austretende Strahlung wird als hohlkegelförmig bezeichnet.
265
bb) Entscheidend für den Aufweitungswinkel der Strahlung ist jedoch eine intrinsische Eigenschaft des Lichtwellenleiters, die numerische Apertur. Beim Übernehmen der konusförmigen Ausgestaltung der distalen Spitze für einen Lichtwellenleiter zur Venenverödung der
N76 hatte der Fachmann Anlass nach Fasern mit geeigneten Eigenschaften zu suchen. Hierzu zählen auch zu erzielende Aufweitungswinkel in Verbindung mit fachmännischer, an die jeweilige numerische Apertur angepasster Faser-Einkopplung. Hierbei wird er Versuche zu Vorrichtungen mit unterschiedlichen Aufweitungswinkeln durchführen, um zu einer Vorrichtung zu gelangen, mit der ein zufriedenstellendes Ergebnis, eine homogene zirkuläre Schädigung, bei der Venenverödung erzielt werden kann (vgl. zu Versuchen des Fachmanns bezüglich des beanspruchten Aufweitungswinkels BGH, Urteil vom 7. September 2021 – X ZR 77/19, Rn. 91 ff.).
266
cc) Bezüglich der Bereichsangabe von 30° bis 40° zeigt die Beklagte in ihren Ausführungen keine konkreten Anhaltspunkte für hieraus resultierende besondere Vorteile oder Wirkungen auf, welche grundsätzlich geeignet wären, eine erfinderische Leistung zu begründen:
267
Die Winkelaufweitung des emittierten Strahls hängt, wie zwischen den Parteien nicht in Streit steht, zudem von der Laserstrahlquelle sowie der Art der Einkopplung des Lichtstrahls in den Wellenleiter ab, wobei die numerische Apertur der Glasfaser als Lichtwellenleiter nur eine Obergrenze für die maximal übertragbare Winkelaufweitung festlegt. Mit ein und derselben Glasfasersonde können unterschiedliche Strahlverteilungen am Ausgang erzeugt werden, die durch unterschiedliche Strahlverteilungen am Eingang hervorgerufen werden können.
268
Dass die mit der Fassung des Hilfsantrags II zusätzlich beanspruchte Winkeldivergenz, wie die Beklagte anführt, in dem auf die Figur 1 Bezug nehmenden Beschreibungsteil des Streitpatents enthalten ist, in welchem die grundlegende Funktion der Lasersonde beschrieben sei, bezeichnet keinen besonderen Vorteil oder eine besondere Wirkung des beanspruchten Bereichs. Der von der Beklagten unter Bezugnahme auf Absatz [0072] als erstrebenswert diskutierte Effekt, auch ohne den Einsatz von Betäubungsmitteln eine schmerzfreie Behandlung durchführen zu können, wird in der Streitpatentschrift nicht der Wahl dieses Aufweitungswinkels zugeschrieben und von der Beklagten in ihrer Argumentation auch nicht allein auf diesen zurückgeführt. Im Hinblick auf die Zulässigkeit ihres Hilfsantrags ist zugunsten der Beklagten an dieser Stelle ihrer Argumentation davon auszugehen, dass sie das zusätzlich aufgenommene Merkmal zum Aufweitungswinkel als Beschränkung der geltenden Fassung des Streitpatents beansprucht und nicht etwa als Beschreibung einer Eigenschaft auffasst, welche dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 der geltenden Fassung stets notwendigerweise anhaftete.
269
Der aus der
N5 bekannte Laserapplikator zur Gewebeablation hat eine radial ringförmige Abstrahlung mit einem anderen, dort beispielhaft benannten Divergenzwinkel von 10° bis 30° in axialer Richtung (vgl. N5, Sp. 4, Z. 31-38; Fig. 2) und zeigt keinen Vorteil des hier beanspruchten Bereichs für den Aufweitungswinkel auf.
270
Bei der von der Beklagten weiter diskutierten Curalux-Faser der
N19 handelt es sich um eine Lasersonde mit Diffusor (vgl. N19, S. 47), der das Laserlicht über einen ausgedehnten Bereich streut und im Vergleich zu dem dort erwähnten „Radialstrahler Glasdom“ ein breites Abstrahlprofil zeigt. Zu der Frage, ob bei dem Einsatz eines Radialstrahlers zur Venenverödung der geltenden Fassung des Streitpatents eine Konstruktion des distalen Endes des Lichteiters gerade unter Verwendung des beanspruchten Winkelbereichs mit besonderen Vorteilen verbunden ist, bietet ein Vergleich mit einer mit einem Diffusor ausgestatteten Sonde jedoch keine weitergehenden Erkenntnisse.
271
Gleiches gilt für Vergleiche zu anderen, aus dem Stand der Technik bekannten Lasersonden mit stumpfem Ende.
272
Der Diskussion der Beklagten zur Energiedichte pro Volumeneinheit folgt der Senat nicht, da im Zusammenhang mit einer zu bestrahlenden Fläche die Energiedichte als Energie pro Flächeneinheit zu verstehen ist.
273
dd) Da mithin weder die Beklagte noch die Streitpatentschrift besondere, mit dem beanspruchten Bereich von 30° bis 40° nachvollziehbar verbundene Vorteile oder Wirkungen nennen und solche für den Fachmann auch unter Berücksichtigung seines Fachwissens nicht zu erkennen sind, wird der Fachmann den beanspruchten Bereich lediglich als eine innerhalb der durch die jeweiligen Randbedingungen gesetzten Grenzen getroffene Auswahl sehen, welche die konkrete Bereichsangabe als von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöst, und eine nach Belieben getroffene Auswahl einer möglichen Bandbreite von Bereichen darstellt, die für sich grundsätzlich nicht geeignet sind, eine erfinderische Leistung zu begründen (vgl. hierzu BPatG, Urteil vom 12. März 2019 – 4 Ni 60/17 (EP), S. 44, letzter Absatz).
274
Weil es sich mithin um eine beliebige Maßnahme handelt, kommt es nicht darauf an, ob der Fachmann Anlass hatte, diese vorzunehmen (BGH, Urt. v. 24. September 2003, X ZR 7/00; GRUR 2004, 47 –; Blasenfreie Gummibahn I), vgl. hierzu ergänzend BPatG, Urteil vom 12. März 2019 – 4 Ni 60/17 (EP), S. 44/45 und BGH, Urteil vom 7. September 2021 – X ZR 77/19).
275
Somit vermag auch das in der Fassung des Hilfsantrags II in den Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal ausgehend von der
N76 in Verbindung mit der
N31 die Patentfähigkeit der beanspruchten Vorrichtung nicht zu begründen.
276
3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des
Hilfsantrags III beruht ausgehend von der
N76 in Verbindung mit der
N31 ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Frage der Zulässigkeit dieses Hilfsantrags bedarf angesichts dessen keiner Erörterung.
277
In dieser Fassung wird die – dichte – Abdeckung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gemäß dem
Merkmal 4.1HIII durch Verschmelzen mit dem Lichtwellenleiter verbunden:
278
M4.1HIII is fixedly secured to the waveguide (100, 200, 500, 600, 800, 900) and sealed with respect thereto
by fusion,
279
Auch eine feste und dichte Anbringung der Abdeckung an den Wellenleiter im Sinne des
Merkmals 4.1HIII erfordert, dass sich die Abdeckung beim Zurückziehen der Vorrichtung aus der Vene nicht vom Wellenleiter löst. Die Anbringung der Abdeckung durch Verschmelzen muss ebenfalls derart dicht sein, dass der angestrebte Behandlungserfolg nicht durch eindringende Flüssigkeiten beeinträchtigt wird. Ein nunmehr beanspruchtes Verschmelzen der Abdeckung aus Quarzglas (
fused silica tube) mit dem Cladding des Lichtleiters (
all silica fiber) dient ebenso wie ein Verkleben einer stabilen Befestigung auch unter Hitzeeinwirkung, dem Schutz vor Verlust der Kappe im Gefäß und der Abdichtung des Innenraums gegenüber eindringenden Flüssigkeiten.
280
Es handelt sich um eine Abwandlung ohne Einfluss auf die Funktionsweise und Ausgestaltung des distalen Endes des beanspruchten Radialstrahlers im Übrigen. Besondere Synergieeffekte des
Merkmals4.1HIII gegenüber den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 dieser Fassung sind weder erkennbar noch vorgetragen. Für die Funktionsweise des in der
N31 beschriebenen Übergangs vom Wellenleiterkern zu Gas bzw. Luft (
fiber core /
air) in Verbindung mit einer Lichtbrechung aufgrund der verschiedenen Brechungsindizes von Wellenleiter und Gas, auf welcher die definierte seitliche Abstrahlung basiert, ist zwar eine gute Abdichtung zur Vermeidung des Eindringens eines Fluids als solche relevant. Irrelevant ist hingegen, ob diese auf einer dichten Verklebung oder einer dichten Verschmelzung beruht.
281
Angesichts dessen kann dahinstehen, ob der Fachmann der N31 (vgl. Fig. 8 – 32) entnahm, dass durch das Verschmelzen von Wellenleiter und Kappe eine noch bessere Abdichtung als durch Verkleben erzielt werden kann (vgl. hierzu auch BPatG, Urteil vom 12. März 2019 – 4 Ni 60/17 (EP) S. 39 Nr. 4), weshalb ihm ein Verschmelzen vorzugswürdig erschien, oder ob es sich ob um zwei verschiedene, gleich wirksame Maßnahmen zur Erzeugung der jeweils geforderten, – für sich genommen nicht steigerbaren – Dichtheit handelt.
282
Beide Varianten zur Abdichtung waren dem Fachmann als fachüblich bekannt. Die Figur 3 der wissenschaftlichen Veröffentlichung N31 mit zugehöriger Beschreibung zeigt eine mit dem Lichtwellenleiter verklebte Abdeckung (vgl. N31, Fig. 3:
adhesive, fused silica tube, This probe is made of an all-silica fiber with a conical distal end and a protecting fused silica tube.), die diese Anforderungen erfüllt. Vorbilder für ein Verschmelzen der Kappe offenbaren unter anderem die Entgegenhaltungen
N50, N69 und
N103. Die Schrift N103 weist den Fachmann auf die Möglichkeit einer Auswahl zwischen beiden hin (vgl. N103, Abs. [0021]:
As noted the tube being the cap is placed over the bared distal end portion of theoptical fiber by thermal fusion of or to laser procedures for BPH, long-term follow-up studies on a buffer coat and vinyl cladding thereof by an adhesive).
283
Ausgehend vom Offenbarungsgehalt der Schriften
N76 und
N31, welchen der Fachmann die Anforderung „fused silica tube“ entnahm, war ihm ein „Verschmelzen“ im Sinne des Hilfsantrags III als – nicht mit konstruktiven Änderungen im Übrigen verbundene – Alternative zu einem „Verkleben“ bekannt. Eine Entscheidung des Fachmanns für die mit der Fassung des Hilfsantrags III beanspruchte Variante begründete daher keine erfinderische Tätigkeit.
284
4. In der Fassung des
Hilfsantrags IV ist in Bezug auf die Abdeckung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 sowohl das
Merkmal 4.1HI „hermetisch“ als auch das
Merkmal 4.1HIII „durch Verschmelzen“ aufgenommen worden. Der Patentanspruch 1 in der Fassung des
Hilfsantrags V kombiniert die Merkmale der Fassungen der Hilfsanträge II und IV.
285
Auch in diesen Fassungen erweist sich das Streitpatent nicht als rechtsbeständig, weil ihrem jeweiligen Patentanspruch 1 ausgehend vom Offenbarungsgehalt der Druckschrift
N76 in Kombination mit der Druckschrift
N31 der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit in Form fehlender erfinderischer Tätigkeit entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Nr. 1, Art. 52, 56 EPÜ). Besondere Synergieeffekte dieser beiden Merkmalskombinationen gegenüber den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 der geltenden Fassung sind über den unspezifischen Hinweis auf eine „verbesserte Gebrauchstauglichkeit“ hinaus nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich.
286
5. In der Fassung des
Hilfsantrag VI hat das Streitpatent aus diesem Grund ebenfalls keinen Bestand. In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag VI wurde in Ergänzung seiner geltenden Fassung die Funktionsangabe aufgenommen, nach welcher sich die beanspruchte Vorrichtung zur Behandlung von Veneninsuffizienzen der Vena Saphena Magna („great saphenous vein“
Merkmal 0HVI) eignet.
287
M0HVI A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies
of the greater saphenous vein by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device comprising:
288
Bei der Vena Saphena Magna handelt es sich, wie der Fachmann weiß, um diejenige Stammvene, die vom Innenknöchel an der Beininnenseite zur Leiste verläuft. Auch die in der
N76 offenbarte Vorrichtung eignet sich zur endoluminalen Laserbehandlung der Stammveneninsuffizienz.
289
Das
Merkmal 0HVI ist somit ebenfalls nicht geeignet eine erfinderische Tätigkeit zu begründen (vgl. die vorherigen Ausführungen zu den weiteren Anspruchsmerkmalen und den Druckschriften N31 und N76, die hier in gleicher Weise gelten).
290
6. Der Patentanspruch 1 in der Fassung des
Hilfsantrags VII kombiniert die Merkmale der Fassungen der Hilfsanträge V und VI dieses Anspruchs. Auf die Ausführungen zu diesen Hilfsanträgen wird Bezug genommen. Besondere Synergieeffekte dieser Merkmalskombination gegenüber den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 der geltenden Fassung sind von der Beklagten nicht vorgetragen und im Übrigen auch nicht ersichtlich.
291
7. Auch in den Fassungen der
Hilfsanträge VIII,
IX und
X hat das Streitpatent keinen Bestand. Auf die Frage der Zulässigkeit dieser Anspruchsfassungen (vgl. hierzu BPatG, Urteil vom 12. März 2019 – 4 Ni 60/17 (EP)) kommt es nicht entscheidungserheblich an.
292
Merkmal 0HVIII des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags VIII ist auf die Verwendung einer Vorrichtung mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 gerichtet:
293
M0HVIIIUse of a device for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device,
the device comprising:
294
Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags IX ist auf die Verwendung der Vorrichtung „für die Bereitstellung eines Systems zur Venenverödung“ gerichtet und beinhaltet folgendes
Merkmal 0HIX:
295
M0IXUse of a device for
providing a system for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull- back-motion of the device,
the device comprising:
296
Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags X mit folgendem
Merkmal0HX wechselt die Patentkategorie hin zu einem „Verfahren zum Bereitstellen eines Systems zur Venenverödung“:
297
M0HXMethod for
providing a system for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device,
using a device comprising:
298
Diese Änderungen führen im Vergleich zur geltenden Fassung zu keiner anderen Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Nr. 1, Art. 52, 56 EPÜ); auf die Ausführungen zur geltenden Fassung dieses Anspruchs wird Bezug genommen. Denn die Zusammenfassung Nr. 100 der Druckschrift
N76 offenbart neben der oben näher beschriebenen Vorrichtung zur endoluminalen Laserablation auch die Verwendung einer solchen Vorrichtung. Für die Verwendung einer Vorrichtung für die Bereitstellung eines Systems zur Venenverödung und für ein Verfahren zum Bereitstellen eines Systems zur Venenverödung ergibt sich nichts Anderes.
299
Auch diese Merkmale sind damit nicht geeignet eine erfinderische Tätigkeit zu begründen (vgl. die vorherigen Ausführungen zu den weiteren Anspruchsmerkmalen, die hier in gleicher Weise gelten).
300
8. Da die Beklagte die abhängigen Unteransprüche der Hilfsanträge I bis X nicht isoliert verteidigt, bedürfen diese keiner gesonderten Prüfung (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2016, X ZR 64/14; GRUR 2017, 57 – Datengenerator). Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausführungen verwiesen.
V.
301
Die aus dem Tenor ersichtliche – zulässige – Fassung des Hilfsantrags XI vom 10. November 2023 erweist sich hingegen als rechtsbeständig, so dass die Klage, soweit sie sich auch gegen diese Fassung richtet, abzuweisen ist.
302
1. Die Fassung des Hilfsantrags XI fügt den Merkmalen der geltenden Fassung des Patentanspruchs 1 neben sprachlichen Anpassungen die Merkmale der erteilten Ansprüche 6 und 7 hinzu (Änderungen durchgestrichen oder unterstrichen):
303
- 0
- A device for endoluminal treatment of venous insufficiencies by applying radiation to the vein wall for occluding the vein during a pull-back-motion of the device comprising:
- Vorrichtung für die endoluminale Behandlung von venösen Insuffizienzen durch Anwenden von Strahlung auf die Gefäßwand zum Verschließen der Vene beim Zurückziehen der Vorrichtung,
- 1
- a flexible waveguide (
100, 200, 500, 600,
800, 900) defining an elongated axis, - mit einem biegsamen Wellenleiter (
100, 200, 500, 600,
800, 900), der eine Längsachse bestimmt, mit - 2
- a proximal end optically connectable to a source of radiation (424), and
- einem optisch mit einer Strahlungsquelle (424) verbindbaren proximalen Ende und
- 3
- a rounded distal end receivable within the blood vessel and
- einem gerundeten von dem Blutgefäß aufnehmbaren distalen Ende,
- 3.1HXI
- including a
first radiation emitting surface (
110, 210, 510, 610) - das eine
erste Strahlung emittierende Oberfläche (
110, 210, 510, 610) aufweist, - 3.1.1
- that emits radiation from the radiation source (424) laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (
100, 200, 500, 600,
800, 900) and annularly from the waveguide (
100, 200, 500, 600,
800, 900) onto an angularly extending portion of the surrounding vessel wall, - die Strahlung von der Strahlungsquelle (424) bezüglich der Längsachse des Wellenleiters (
100, 200, 500, 600,
800, 900) in seitliche Richtung und vom Wellenleiter (
100, 200, 500, 600,
800, 900) aus ringförmig auf einen sich über einen Winkelbereich erstreckenden Abschnitt der umgebenden Gefäßwand emittiert, - 3.1.2
- wherein the emitting surface (210, 510, 610) is oriented at an acute angle with respect to the elongated axis of the waveguide (
100, 200, 500, 600,
800, 900) and wherein the emitting surface (
110, 210, 510, 610) is substantially conical shaped, the device further comprising - wobei die Strahlung emittierende Oberfläche (210, 510, 610) in einem spitzen Winkel zur verlängerten Achse des Wellenleiters (
100, 200, 500, 600,
800, 900) angeordnet und die Strahlung emittierende Oberfläche (
110, 210, 510, 610) im Wesentlichen kegelförmig ist, - 3aHXI
- a lateral radiation emitting distal region (204, 504, 604)
- die ferner einen Strahlung seitlich emittierenden distalen Bereich (204, 504, 604) aufweist,
- 3a.1HXI
- defined by the first radiation emitting surface (210, 510, 610) and a plurality of second radiation emitting surfaces (208, 508, 608)
- der von der ersten Strahlung emittierenden Oberfläche (210, 510, 610) und einer Vielzahl von strahlungsemittierenden Oberflächen(208, 508, 608) gebildet ist,
- 3a.1.1HXI
- axially spaced relative to each other along a distal region of the waveguide (200, 500, 600, 900),
- die entlang eines distalen Bereichs des Wellenleiters (200, 500, 600, 900) untereinander in axialer Richtung im Abstand angeordnet sind,
- 3a.2HXI
- wherein the plurality of second radiation emitting surfaces (208, 508, 608) are located proximally with respect to the first radiation emitting surface (210, 510, 610) and axially spaced relative to each other,
- wobei die Vielzahl von zweiten strahlungsemittierenden Oberflächen(208, 508, 608), die bezüglich der ersten strahlungsemittierenden Oberfläche (210, 510, 610) proximal angeordnet sind und in axiale Richtung im Abstand zueinander angeordnet sind,
- 4
- – a cover (
106, 206, 506, 606, 906) that - – eine Abdeckung (
106, 206, 506, 606, 906), - 4.1
- is fixedly secured to the waveguide (
100, 200, 500, 600,
800, 900) and sealed with respect thereto, - die am Wellenleiter (
100, 200, 500, 600,
800, 900) befestigt und dicht angebracht ist, - 4.2
- substantially transparent with respect to the emitted radiation,
- bezüglich der emittierten Strahlung im Wesentlichen transparent ist,
- 4.3
- that encloses the emitting surface (
110, 210, 510, 610) therein, and that - die emittierende Oberfläche (
110, 210, 510, 610) einschließt und - 4.4
- defines a gas-waveguide interface that refracts emitted radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (
100, 200, 500, 600,
800, 900) onto the surrounding vessel wall, - eine Gas-Wellenleiterschnittstelle bildet, die emittierte Strahlung bezüglich der Längsachse des Wellenleiters (
100, 200, 500, 600,
800, 900) in seitliche Richtung auf die umgebende Gefäßwand bricht, - 4a.5HXI
- wherein the axially-extending cover (206, 506, 606, 906) encloses the lateral radiation emitting distal region (204, 504, 604),
- wobei die sich in axialer Richtung erstreckende Abdeckung (206, 506,606, 906) den seitlich emittierenden distalen Bereich (204, 504, 604)umschließt,
- 4a.6HXI
- forms a gas interface at each of the plurality of second radiation emitting surfaces (208, 508, 608) that is sealed with respect to the exterior of the waveguide (200, 500, 600, 900), and
- eine Gasschnittstelle an jeder der Vielzahl von strahlungsemittierenden Oberflächen (208, 508, 608) bildet, die zum Außenraum des Wellenleiters (200, 500, 600, 900) hin abgedichtet ist und
- 4a.7HXI
- cooperates with the angled arcuate surface contour of at least a plurality of the radiation emitting surfaces (208, 210, 508, 510, 608, 610) to deflect radiation laterally with respect to the elongated axis of the waveguide (200, 500, 600, 900), and
- die mit dem schräg abgewinkelten Oberflächenprofil von wenigstens einer Vielzahl von strahlungsemittierenden Oberflächen (208, 508, 608) zusammenwirkt, um Strahlung bezüglich der Längsachse des Wellenleiters (200, 500, 600, 900) in seitliche Richtung auszulenken, und
- 5a
- – at least one laser source (424) that provides laser radiation of 1470 nm +/- 30 nm or 1950 nm +/- 30 nm, wherein the proximal end of the waveguide (
100, 200, 500, 600,
800, 900) is optically coupled to the at least one laser source (424). - – mindestens eine Laserquelle (424), die Laserstrahlung mit einer Wellenlänge von 1470 nm +/- 30 nm oder 1950 nm +/- 30 nm aussendet und mit der das proximale Ende des Wellenleiters (
100, 200, 500, 600,
800, 900) optisch gekoppelt ist.
304
2. Diese Fassung ist zulässig.
305
Die Merkmale ihres unabhängigen Patentanspruchs 1 ergeben sich aus den Anmeldeunterlagen des Streitpatents. Sie sind in den Patentansprüchen 1, 2, 3, 8, 9 und 13 der Offenlegungsschrift offenbart, welche in der geltenden Fassung den Ansprüchen 1, 6 und 7 entsprechen. Die Ausführungsbeispiele der oben eingefügten Figuren 2a und 5 offenbaren sämtliche baulichen Merkmale dieser Anspruchsfassung.
306
Verglichen mit der Zweckangabe des ursprünglichen Anspruchs 1 ist der Einsatzzweck durch die Behandlung von Veneninsuffizienzen präzisiert, was dem Absatz [0055] der Offenlegungsschrift zu entnehmen ist. Hierbei wird die Venenwand bestrahlt, um diese zu verschließen (
occlude entspricht
close, vgl. Abs. [0088]), wie es dem allgemeinen Teil der Absätze [0031] und [0035] zu entnehmen ist. Dass das Verschließen während des Rückziehens der Vorrichtung geschieht, entnimmt der Fachmann der Offenlegungsschrift (z. B.
pullback actuator in Fig. 4, insbesondere Abs. [0060] in Verbindung mit mehreren strahlungsemittierenden Oberflächen).
307
Das aus dem ursprünglichen Anspruch 8 gestrichene Merkmal („the first radiation emitting surface is formed at the distal tip“) war bereits in den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 3 enthalten („rounded distal end including a radiation emitting surface“, „substantially conical shaped“).
308
Durch die Aufnahme der zusätzlichen Merkmale der Patentansprüche 6 und 7 in den Patentanspruch 1 wirkt die geänderte Fassung gegenüber der geltenden Fassung beschränkend.
309
Nachdem die Parteien die Offenbarung von Merkmalen der Unteransprüche – im Ergebnis zutreffend – als zur Erfindung gehörend nicht in Abrede gestellt haben, wird auf die Darstellung weiterer Details hierzu verzichtet.
310
2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des
Hilfsantrags XI ist neu und beruht gegenüber dem in diesem Verfahren zu berücksichtigenden Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tätigkeit; der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit ist daher nicht gegeben (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ i. V. m. Art. 56 EPÜ).
311
a) In der Ausgestaltung des Hilfsantrags XI weist die Vorrichtung einen seitlich emittierenden, distalen Bereich auf, welcher neben der kegelförmigen Spitze als erster Strahlung emittierender Oberfläche zudem durch eine Vielzahl von weiteren strahlungsemittierenden Oberflächen gebildet wird (
Merkmale 3aHXI und
3a.1HXI). Die zahlreichen weiteren strahlungsemittierenden Oberflächen sind im distalen Bereich des Wellenleiters, proximal zur ersten strahlungsemittierenden Oberfläche und untereinander in axialer Richtung beabstandet angeordnet (
Merkmale 3.1.1. und
3a.2HXI).
312
Gemäß der Streitpatentschrift wird eine der weiteren Emissionszonen bei hoher Laserleistung zum vollständigen Koagulieren einer Stelle der Vene verwendet (vgl. Abs. [0047]), oder sie trägt bei weniger Laserleistung, wobei die Wechselwirkung zeitlich auf die Dauer des Vorbeiziehens begrenzt ist, zum Energieeintrag an einer Stelle bei (vgl. Abs. [0049]).
313
Des Weiteren ist der Begriff „angled arcuate surface contour“ (Teilmerkmal von
Merkmal 4a.7HXI), der Vielzahl von strahlungsemittierenden Oberflächen, mithilfe der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen. Abgesehen vom Anspruch sind Details hierzu dem Absatz [0081] der Streitpatentschrift zu entnehmen (Abs. [0081]:
For example, although certain embodiments employ emitting surfaces that are substantially conical shaped, emitting surfaces defining otherarcuate surface contours(i. e., surface contours that are curved), or defining non-arcuate surface contours, such as one or more flat, and/or angled emitting surfaces, equally may be employed).
314
Unter Berücksichtigung des Offenbarungsgehalts der Figur 9 (vgl. dort Bezugszeichen (908)) sowie in den Figuren 2a, 5 und 6 (vgl. dort Bezugszeichen (208, 508 und 608)) kommt dem Begriff “arcuate” nicht nur die Bedeutung „abgebogen“ sondern auch die Bedeutung „abgewinkelt“ zu. Es handelt sich demnach um ein schräg abgewinkeltes Oberflächenprofil.
315
b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags XI wird von keiner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen neuheitsschädlich vorweggenommen.
316
c) Er beruht zudem auf einer erfinderischen Tätigkeit:
317
aa) Dem vom Offenbarungsgehalt der
N31 ausgehenden Fachmann fehlt die Veranlassung, dem
Merkmal 3a.2HXI entsprechend eine Vielzahl von Emissionsflächen entlang der Faser vorzusehen.
318
Er entnimmt dem in Fig. 3 dargestellten Aufbau (vgl. Abbildung oben), dass die Kappe so nahe an der konisch geformten Spitze angebracht ist, dass kaum Platz für eine zusätzliche Emissionsfläche bliebe. Ausgehend von dem dort abgebildeten Aufbau hätte es größerer baulicher Änderungen bedurft, um mehrere Emissionsflächen entlang der Faser innerhalb der Kappe zu realisieren.
319
bb) Aus diesem Grund führt auch eine Kombination der
N76 mit dem Offenbarungsgehalt der
N31 nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 dieser Fassung.
320
cc) Ausgehend von einer Kombination der Druckschriften
D76 und
D82 erweist sich dieser Gegenstand ebenfalls als erfinderisch:
321
(1) Wie zum Patentanspruch 1 der geltenden Fassung ausgeführt, offenbart die
N76 eine Vorrichtung mit einem radial abstrahlenden Wellenleiter für die Laserbehandlung der Stammveneninsuffizienz bei 1470 nm (
Merkmale 0, 1, 2, 3, 3.1HXI, 3.1.1 und
5a), und der Fachmann schaute sich zur konstruktiven Ausgestaltung des distalen Endes seines „Radialstrahlers“ im Stand der Technik um.
322
(2) Eine Ausgestaltung des distalen Endes war auch in der wissenschaftlichen Veröffentlichung
N82 zu finden. Diese befasst sich unter dem Titel „Diffusing Fiber Tips for High-Power Medical Laser Application“ mit radial abstrahlenden Lichtleitern für hohe Laserleistungen.
323
Die dort beschriebenen Applikatoren wurden für die photodynamische Therapie und die Laser-induzierte Thermotherapie konzipiert; Abbildung 6 zeigt eine Schnittzeichnung durch einen PDT-Applikator zur Behandlung von Zervixdysplasien. Der flexible Wellenleiter aus Quarz-/Quarzfasern mit Kerndurchmessern zwischen 600 µm und 1250 µm und einer NA von 0,2 sowie Hardcladfasern von 600 µm bis 1000 µm und NA = 0,37 verfügt über ähnliche Abmessungen wie der Lichtleiter der N76. Die aus der Glasfaser austretende Lichtleistung kann dort reproduzierbar eingestellt werden (
Merkmale 1 und
2).
 Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
Abbildung in Originalgröße in neuem Fenster öffnen
324
Der Wellenleiter hat am distalen Ende eine kegelförmig im spitzen Winkel angeordnete Oberfläche (Abb. 6,
Merkmal 3.1.2), welche Strahlung in seitliche Richtung emittiert (Abb. 6, Abb. 5: letztes Signal, die dortige Zusammenfassung offenbart eine zylindersymmetrische Abstrahlcharakteristik
, Merkmale 3.1HXI und
3.1.1). Eine Vielzahl von zweiten Emissionsoberflächen (Abb. 6 i. V. m. Abb. 5
Merkmal 3a.1HXI) ist entlang des distalen Bereichs des Wellenleiters in axialer Richtung voneinander beabstandet und proximal zur Spitze angeordnet (Abb. 6,
Merkmale 3aHXI,
3a.1HXI,
3a.1.1HXI und
3a.2HXI).
325
Zudem weist die Vorrichtung eine Abdeckung in Form einer im distalen Bereich abgerundeten Glaskapillare auf (vgl. Abb. 6, Ergebnisse:
Um bei Anwendungen im Körperinneren ausreichende mechanische Stabilität zu gewährleisten und die aufgerauhten Stellen vor Benetzung zu schützen, wurde eine von innen aufgerauhte Glaskapillare über das bearbeitete Faserende gestülpt.,Merkmale 3 und
4).
326
Die Abdeckung ist im Wesentlichen („substantially“) für die Strahlung transparent (
Merkmal 4.2) und umschließt die emittierenden Oberflächen (Abb. 6,
Merkmale 4.3 und
4a.5HXI). Durch die eingeschlossene Luft bildet sich sowohl an der Spitze, als auch bei der Vielzahl von strahlungsemittierenden Oberflächen eine Gas-Wellenleiterschnittstelle, welche die emittierte Strahlung in seitliche Richtung bricht (Abb. 2,
Merkmale 4.4 und
4a.6HXI).
327
Diese Schnittstelle wirkt mit dem Oberflächenprofil der Vielzahl von strahlungsemittierenden Oberflächen zusammen, um die Strahlung seitlich abzulenken (vgl. Abb. 2, 5 und 6). Ein schräges gewölbtes Oberflächenprofil ist ebenfalls offenbart (vgl. Abb. 2 i.V.m. Abb. 4,
Merkmal 4a.7HXI).
328
(3) Vom Offenbarungsgehalt der N76 ausgehend wird der Fachmann sich zur konstruktiven Ausgestaltung des Radialstrahlers jedoch nicht am Inhalt der N82 orientieren. Wie der dortigen Abbildung 6 zu entnehmen ist, erstreckt sich deren Glaskapillare mit dem Ziel einer gleichzeitigen Bestrahlung von Gebärmuttermund und -hals in distaler Richtung geradlinig über einen weiten Teil des Wellenleiters. Dieser Aufbau mit einer Glaskapillare steht einer Verwendung in einer Vene zur Venenverödung im Sinne des
Merkmals0 entgegen. Venen weisen einen kurvigen Verlauf auf. Eine Vorrichtung zur Venenverödung gemäß der N76 muss daher in ihrer Gesamtheit, insbesondere auch an ihrem distalen Ende, das in der Vene zurückgezogen werden soll, die hierzu erforderliche Flexibilität aufweisen.
329
Auch wenn in der
N82 davon die Rede ist, dass mithilfe der dort beschriebenen Bearbeitungsmethode unterschiedliche Applikatoren aufgebaut wurden, so handelt es sich bei der Schnittzeichnung der Abbildung 6 um die einzige nähere Beschreibung eines solchen Aufbaus. Applikatoren ohne über das bearbeitete Faserende gestülpte, von innen aufgerauhte Glaskapillare offenbart die N82 nicht. Somit entnahm der Fachmann der Offenbarung der N82 keine Anregung zur konkreten Ausgestaltung eines Radialstrahlers zur Venenverödung nach Maßgabe der N76.
330
dd) Auch durch eine Kombination der Druckschriften N76 mit weiteren, von der Klägerin angegebenen Schriften aus dem Stand der Technik gelangte der Fachmann nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags XI:
331
(1) Schaute sich der Fachmann, vom Offenbarungsgehalt der N76 ausgehend, zur konstruktiven Ausgestaltung des distalen Endes seines „Radialstrahlers“ im Stand der Technik um, traf er außerdem auf die Druckschrift
N13. Zur Kombination beider Lehren hatte der Fachmann jedoch keinen Anlass:
332
Die Faser der
N13 wird eingesetzt, um sichtbares Licht wie Sonnenlicht zu Heilungszwecken zu einer Körperpartie zu leiten, die im Inneren des Körpers liegt (vgl. Sp. 1, Z. 4ff.:
The present invention relates to an endoscope or insertion tool for guiding radiation light rays for use in medical treatment which is preferable for radiating light rays such as solar rays, etc. effective for medical treatment onto the inner surface of mouth interior, ear, nose. throat, rectum, and so on.). Hierbei wird nur das sichtbare Licht ohne Infrarotanteil verwendet (vgl. Sp. 2, Z. 12:
the light rays radiated onto the diseased part of the patient are to be the light rays corresponding to the visible light rays component of solar rays containing therein neither ultraviolet nor infrared.).
333
Gegen eine sinnvolle Kombination dieser Offenbarung mit der Lehre der N76 spricht somit, dass sich die Vorrichtung der N13 nicht für eine koagulierende Venenbehandlung mit hohen Lichtstärken eignet, kein Laser als Strahlungsquelle vorgesehen ist und die Offenbarung keine Wellenlänge im Infrarot-Bereich betrifft.
334
(2) Vom Offenbarungsgehalt der N76 ausgehend gelangte der Fachmann auch nicht zu einer Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags XI, sofern er sich zur konstruktiven Ausgestaltung des distalen Endes an der Vorrichtung der
N73 orientierte: Anstelle einer konischen Faserspitze schließt hier ein Reflektor für Wärmestrahlung, aus welcher die Temperatur des Gewebes bestimmt werden kann, das distale Faserende ab. Zur Umgestaltung dieser Spitze nach Maßgabe des
Merkmals 3.1.2 des Streitpatents bestand keine Veranlassung.
335
(3) Gleiches gilt vom Offenbarungsgehalt der N76 ausgehend für eine mögliche Kombination mit dem distalen Ende der Vorrichtung der Druckschrift
N103: Es bestand keine Veranlassung, das in der N103 mit einem Lichtdiffusor versehende Faserende umzugestalten und diesen durch eine kegelförmige Spitze nach Maßgabe des
Merkmals 3.1.2 zu ersetzen.
336
(4) Alle weiteren im Verfahren befindlichen Schriften, die mehrere Emissionsstellen entlang der Faser zeigen, darunter auch die Entgegenhaltung
N109, offenbaren ebenfalls Diffusoren, bei welchen das Licht die Faser nicht als Strahlenbündel verlässt, sondern zerstreut wird. Ein spitzes distales Ende wie das in der N109 offenbarte eignet sich zudem nicht für das Einführen und das Zurückziehen in einer Vene, was den Fachmann von einer Kombination mit der N76 zusätzlich abhält. Vom Offenbarungsgehalt der N76 ausgehend gelangte der Fachmann somit nicht zu einer Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags XI.
337
ee) Die Auswahl eines anderen Ausgangspunkts als der N76 aus den im Verfahren befindlichen Schriften führte bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 dieser Fassung zu keinem anderen Ergebnis.
338
(1) Die ebenfalls vorveröffentlichte Druckschrift
N50 trägt den Titel „Endovenous closure of varicose veins with mid infrared laser“ und offenbart eine Vorrichtung mit einer Laser-Strahlungsquelle und einem Wellenleiter (
optic fiber / optical fibre laser delivery device), welche unter der Verwendung von Laserstrahlen zur Verödung von Krampfadern eingesetzt wird. Die Verödung wird erreicht, indem das Gerät in die zu behandelnde Vene eingeführt wird, wobei die Bestrahlung dann beim Zurückziehen der Vorrichtung erfolgt (vgl. Titel, Abstract und u. a. Fig. 9A-C sowie Abs. [0028], [0090] und [0094]). Aus dieser Druckschrift ist ein Diffusor mit plan gestaltetem Wellenleiterende bekannt, der das Licht diffus streut und im
 Unterschied zu einem Radialstrahler nicht in eine definierte Richtung abstrahlt (vgl. nebenstehende Figuren 9A bis C). Unter anderem sind die
Unterschied zu einem Radialstrahler nicht in eine definierte Richtung abstrahlt (vgl. nebenstehende Figuren 9A bis C). Unter anderem sind die
Merkmale 3.1.1,
3.1.2 und
3a.2HXI nicht erfüllt. Die in N50 vorgeschlagene diffus streuende Spitze führt nicht zu einer ringförmigen Emission der Strahlung im Sinne von
Merkmal 3.1.1. Vielmehr wird die Strahlung in alle Richtungen verteilt. Darüber hinaus ist in N50 nicht offenbart, dass die Oberfläche der Lichtfaser an deren distalem Ende in besonderer Weise ausgestaltet ist, um einen seitlichen Austritt der Strahlung zu ermöglichen. Als Mittel, die eine Ablenkung in diese Richtung bewirken, werden nur die Abdeckung und der optionale Luftspalt angeführt (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 7. September 2021 – X ZR 77/19, Rn. 125, 126). Da die N50 bereits durch die Diffusorspitzen einen vorteilhaft beschriebenen Lösungsweg aufzeigt, hatte der Fachmann keine Veranlassung, hiervon ausgehend nach einer Lösung zu suchen, bei der die seitlich austretende Strahlung auf einen ringförmigen Bereich konzentriert wird und eine Vielzahl von weiteren seitlich emittierenden Emissionsoberflächen vorzusehen.
339
Durch eine Kombination der Druckschrift
N50 mit dem Offenbarungsgehalt einer der Druckschriften
N82,
N15,
N73 oder
N103 gelangt der Fachmann somit nicht ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags XI.
340
(2) Dies gilt in gleicher Weise, sofern aus den weiteren im Verfahren befindlichen Schriften eine andere Druckschrift, die keinen Radialstrahler zeigt, als Ausgangspunkt zur Beurteilung erfinderischer Tätigkeit betrachtet wird:
341
(a) Die von der Klägerin angeführte Druckschrift
N2 betrifft ebenfalls einen Diffusor mit aufgerautem Wellenleiterende, welcher diffus abgestrahltes Licht erzeugt.
342
(b) Bei der aus der Druckschrift
N68 bekannten Wellenleiter-Vorrichtung wird die Verödung von oberflächlichen Blutgefäßen durch Einstiche in die Haut vorgenommen, so dass in Richtung der Längsachse auf die Wand des Blutgefäßes emittiert wird. Eine radial abstrahlende Faserspitze ist nicht offenbart, der Fachmann hat ausgehend von der N68 keine Veranlassung, eine solche und zusätzliche weitere Strahlungsoberflächen einzubauen.
343
(3) Auf der Suche nach verbesserten Vorrichtungen zur endoluminalen Behandlung von venösen Insuffizienzen bestand kein Anlass, ausgehend von Entgegenhaltungen, die, – wie die oben diskutierte N31 – andere Anwendungsgebiete betreffen, Verbesserungen in dieser Richtung in Betracht zu ziehen (vgl. BGH, Urteil vom 7. September 2021 – X ZR 77/19, Rn. 170).
344
Die weiteren Druckschriften liegen noch ferner ab und legen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrag XI ebenfalls nicht nahe.
345
d) Die auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Unteransprüche dieser Fassung erfüllen ebenfalls die an sie hinsichtlich ihrer Schutzfähigkeit zu stellenden Anforderungen.
346
Aus diesen Gründen war die Klage war abzuweisen, soweit sie sich gegen die Anspruchsfassung des Hilfsantrag XI richtet. Der Patentanspruch 1 und mit ihm die ebenfalls angegriffenen Unteransprüche dieses Hilfsantrags erweisen sich als rechtsbeständig.
347
Über den in seiner Reihenfolge nachrangig gestellten Hilfsantrag XII der Beklagten war mithin nicht mehr zu entscheiden.
VI.
348
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO.
349
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.